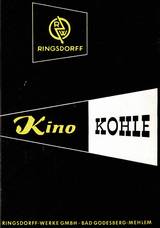Die ersten Cinemascope Bildwände brauchten noch mehr Licht
Ein neues Zeitalter bricht an. Die Bildbreite der Cinemascope- Kino-Bildwand wurde mehr als verdoppelt (2.55:1) und teilweise bis zu 18 Metern breit. Damit wurde die herkömmliche Kinotechnik ausgereizt. Diese Fläche wollte gut ausgeleuchtet werden. Mehr kommt in diesem RINGSDORFF-WERKE Heftchen aus 1954.
.
Kinoprojektionskohlen und ihre Anwendung
(Ein Handbuch für den Filmvorführer 1954)
von Heinz Bingel - Druckschrift-Nr. L 211
.
- Anmerkung : In dem ganzen Heftchen - auch wieder mit 64 Seiten - steht kein Datum. Doch es ist das erste Heftchen, bei dem die neue Cinemascope-Technik mit den neuen Bildfenstermasken explizit angesprochen und verarbeitet wurde. Die ersten Kinos wurden Anfang/Mitte 1954 umgerüstet, daher unser Titel mit 1954.
.
DER INHALT
.
- Einleitung: 140 Jahre elektrisches Bogenlicht! . 3
- 1. Warum „Bogenlicht"? . .... 4
- 2. Was sind „Reinkohlen" ? . . . . 5
- 3. Was sind „Beckkohlen" ? .... 9
- 4. Was sind „Wechselstromkohlen" ? . . 12
- 5. Wie schaltet man Bogenlampen? ... 14
- 6. Wieviel Licht braucht Ihre Bildwand? . . 17
- 7. Kennen Sie Ihre Spiegellampe? ... 24
- 8. Wie brennt man Reinkohlen? ... 30
- 9. Wie brennt man Beckkohlen? ... 35
- 10. Ist Becklicht „blau" ?..... 43
- 11. Welche Kohlenpaarung braucht Ihr Bildwerfer ? 45
- 12. Haben Sie noch eine Frage? ... 50
- 13. Wie werden Lichtkohlen hergestellt? . . 51
- 14. Winke für die Praxis ... 57
- RW-Außenbüros für Kinokohlen ... 64
.
RINGSDORFF-WERKE GMBH • BAD GODESBERG-MEHLEM • Ruf: Bad Godesberg 12001 • Draht: Kohlebuerste Badgodesberg • Fernschreiber: 0886/668
.
EINLEITUNG - "140 Jahre elektrisches Bogenlicht!"
Als der Engländer Davy im Jahre 1810 die Entdeckung machte, daß man mit einer Gleichspannung aus ca. 2000 galvanischen Elementen elektrisches Licht zwischen zwei Kohlenspitzen erzeugen konnte, ahnte niemand seiner Zeitgenossen, daß hiermit ein wichtiger Grundstein zu einer damals noch gar nicht existierenden Technik gelegt worden war.
Denn - das dürfte wohl feststehen - ohne Mithilfe der elektrischen Bogenlampe hätte weder die Filmaufnahme, noch die Wiedergabetechnik eine derartig rasch aufsteigende Entwicklung nehmen können, die heute in der Breitbild- und Panorama-Projektion einen vorläufigen Abschluß fand.
Allerdings bestehen zwischen den Holzkohlestäbchen, mit denen man vor mehr als 100 Jahren elektrisches Bogenlicht erzeugte, und den heute verwendeten Kinoprojektionskohlen wesentliche Unterschiede.
Die Kunstkohlen-Industrie hat keine Mittel gescheut, immer wieder neue Wege zu suchen, die Lichtleistung ihrer Kohlestifte ständig zu verbessern. So gibt es heute eine anscheinend verwirrende Vielzahl von Kinokohlen der verschiedensten Typen, Dimensionen und Anwendungsgebiete.
.
Aktuelle Fragen ....
Brennen in Ihren Bogenlampen die zweckmäßigsten Kohlen? Ist die gewählte Stromstärke den Erfordernissen Ihrer Bildprojektion auch richtig angepaßt? Sind Bildausleuchtung und Bildhelligkeit beim Breitbild zufriedenstellend?
Das sind Fragen, die Sie nur dann beantworten können, wenn Sie mit der etwas schwierigen Materie der Bogenlicht-Technik vertraut sind und auch die komplizierten optischen Verhältnisse in den Projektionslampen kennen. Hier hilfreich einzugreifen, soll der Zweck dieses Büchleins sein.
1939 - „Die Bogenlichtkohle in der Kinoprojektion"
Unserem Handbuch „Die Bogenlichtkohle in der Kinoprojektion", das am Anfang des zweiten Weltkrieges erschien und inzwischen seine 4. Auflage erlebt hat, war bereits die Aufgabe gestellt, dem Kinotechniker wie auch besonders dem Vorführer am Bildwerfer ein Ratgeber und Helfer zu sein.
Weil die Entwicklung der Kinoprojektionstechnik inzwischen bedeutende Fortschritte machte, sahen wir uns zu einer völligen Neubearbeitung veranlaßt, in der auch die lichttechnischen Probleme der Jetztzeit behandelt werden.
Das Ergebnis ist diese Druckschrift, deren Verfasser nach 10jähriger Tätigkeit als Filmvorführer und nach 15jährigem Wirken in unserem Lichtkohlen-Prüffeld noch heute als Ingenieur unseres Kundendienstes lichttechnische Erfahrungen sammelt.
Wir hoffen, daß dieses kleine Buch - ebenso wie seine früheren und vergriffenen Ausgaben - Ihren Beifall findet und nicht nur Ihnen als Theaterbesitzer oder Vorführer wertvolle Anregungen gibt, sondern gleichzeitig auch dem Vorführernachwuchs wichtige Kenntnisse vermittelt.
.
1. Warum „Bogenlicht"?
..... und warum verwendet man als Projektions=Lichtquelle keine Glühlampe?
Wenn man in der Schmalfilmwiedergabe und sogar in Normalfilm= koffergeräten mit Lampen von 500 oder 1000 Watt auskommt, müßte es einer fortgeschrittenen Industrie doch möglich sein, für größere Anforderungen auch solche von 2000 oder 5000 Watt zu konstruieren?
So mag schon mancher Lehrling vom Vorführernachwuchs gedacht haben, als er durch falsche Einstellung den Lichtbogen nicht aus dem Zischen herausbekam oder sich beim Kohlenwechsel das erstemal die Finger verbrannte.
Es dürfte nicht unzweckmäßig sein, Ihnen daher zur Einführung in unser Thema „Die Bogenlichtkohle in der Kinoprojektion" einmal ganz kurz den Unterschied zwischen Glühlicht- und Bogenlichtprojektion aufzuzeigen.
Zunächst ein Wort zu dem Ausdruck „Bogenlicht".
Er ist zwar allgemein üblich, jedoch recht irreführend, soweit es sich um die üblichen mit Gleichstrom betriebenen Kino-Bogenlampen handelt.
Wenn wir zwei Kohlestifte mit den Polen einer geeigneten Gleichstromquelle verbinden, ihre Spitzen miteinander in Berührung bringen und sie dann einige Millimeter auseinander ziehen, dann bildet sich bekanntlich zwischen den aufglühenden Spitzen eine stromleitende, flammenartige Brücke, die wir „Lichtbogen" nennen.
Dieser selbst hat aber nur eine sehr geringe Lichtstärke. Bedeutend heller und für unsere Zwecke allein von Interesse ist vielmehr das von den Kohlenspitzen, besonders von der positiven Kohlenspitze ausgestrahlte Licht.
Diese Kohlenspitze höhlt sich während des Abbrandes kraterförmig aus und nimmt dabei eine Temperatur von 4000°-6000°C an, während sich die negative Kohle zuspitzt und weit weniger erhitzt.
Eigentlich „Kraterlicht" statt „Bogenlicht"
Der in heller Weißglut befindliche Positivkrater stellt somit die eigentliche Lichtquelle unseres Gleichstrombogens dar, so daß es durchaus besser wäre, von „Kraterlicht" statt von „Bogenlicht" zu sprechen.
Vergleichen wir nun einmal einen solchen leuchtenden Krater mit den Leuchtwendeln einer Glühlampe! Die folgende Zeichnung sagt Ihnen dazu wohl mehr als viele Worte (Abb. 1).
Abbildung 1
Sie sehen, daß der Krater vorzugsweise nach einer Richtung hin strahlt; während das Licht der Glühwendel sich nach allen Seiten ausbreitet.
Noch bevor wir Ihnen das optische System der Spiegellampe erläutern, dürften Sie hier bereits einsehen, daß das Kraterlicht bedeutend verlustloser zur Filmbildbeleuchtung ausgenutzt werden kann als das einer Glühwendel-Anordnung.
Ferner stellt solch ein Krater eine kleine gleichmäßiger leuchtende Fläche dar als mehrere nebeneinanderliegende Glühfäden, die zudem in Temperatur und Leuchtdichte auch nicht annähernd an den Krater heranreichen.
Nicht zuletzt ist ein Kraterlicht, trotz des laufenden Verbrauches an Kohlestiften, wesentlich billiger und im Stromverbrauch wirtschaftlicher als Glühlampen-Licht.
Ein Beispiel
Es wird Sie vielleicht wundern, daß z. B. bei einem 16mm Bildwerfer der für die Filmprojektion nutzbar werdende Lichtstrom nur einen geringen Bruchteil der von einer 500-Watt-Lampe aufgenommenen Leistung beträgt.
Inwieweit das Kraterlicht einer Bogenlampe für Kinoprojektionszwecke besonders gut geeignet ist, werden Sie aus den weiteren Kapiteln dieser Schrift noch näher ersehen.
Unsere Frage: „Warum Bogenlicht?" wäre also in der Hauptsache schon beantwortet. Es liegt wohl nichts näher, als in den folgenden Abschnitten zunächst einmal zu erläutern, welche Arten von Bogenlichtkohlen es gibt, die ein geeignetes Kraterlicht für Kinoprojektionen erzeugen.
.
2. Was sind „Reinkohlen"?
Die einfachste Form einer „Reinkohlen"- Paarung besteht aus zwei einfachen homogenen Kohlestiften gleichen Durchmessers. Zündet man hiermit einen Lichtbogen, so kann man folgendes beobachten:
1. Wie schon in Kapitel 1 kurz erwähnt wurde, bildet sich am Brenn-Ende der Positivkohle ein Krater, an dem Ende der Negativkohle eine Spitze.
2. Die positive Kohle brennt doppelt so schnell ab wie die negative Kohle.
3. Der Lichtbogen ist ausgesprochen unruhig, flackert und gibt dabei ein zischendes Geräusch von sich.
Mag diese Bogenunruhe Herrn Davy, von dem bereits die Rede war, in seiner Entdeckerfreude auch nicht sonderlich gestört haben, so ist doch für unsere Zwecke ein flackernder Lichtbogen völlig unbrauchbar.
.
Abhilfe : ein gefüllter Dochtkanal
Zur Stabilisierung des Bogens hat man ein recht einfaches Mittel entdeckt: den gefüllten Dochtkanal. Versieht man nämlich den als Positivkohle bestimmten Kohlestift mit einem durchgehenden Kanal und füllt diesen mit leicht
verbrennendem Kohlenstoff und einem bestimmten Bindemittel aus, so wird der Lichtbogen stabil.
Ein Zischen tritt nur noch dann auf, wenn die Kohle überlastet wird, also mehr Strom erhält, als ihr zuträglich ist.
Diese Grenzbelastung liegt bei etwa 0,3 A/mm2 (Ampere je Quadratmillimeter Querschnitt). Da die für Reinkohlen empfohlenen Stromdichten mit 0,2 bis 0,25 A/mm2 verhältnismäßig klein sind, spricht man in diesem Zusammenhang auch von „Niederintensitätskohlen".
.
Abbildung 2
In Abbildung 2 sehen Sie eine gedochtete Positivkohle der Länge nach aufgeschnitten. Der Durchmesser des Dochtes beträgt etwa 1/3 des Außendurchmessers der Kohle.
Eine solche Positiv-Reinkohle hat noch eine weitere Eigenschaft, die, wie Sie später sehen werden, für die richtige Ausnutzung des Kraterlichtes in der Lampe von entscheidender Bedeutung ist: Der Kraterdurchmesser ist - ohne Rücksicht auf den Außendurchmesser der Kohle - von der Stromstärke abhängig, und zwar wächst der Krater mit steigender Stromstärke.
-
Abb. 3
Abb. 3 zeigt Ihnen z. B. die verschiedenen Kratergrößen einer 12mm Positivkohle, die nacheinander mit 20, 25 und 30 Ampere gebrannt wurde.
Ist es dann nicht etwa gleichgültig, ob wir für z. B. 20 Ampere Belastung eine Kohle von 10mm 0 oder 12mm 0 wählen?
Nein! Zwar erzielen wir die gleichen Kratergrößen, aber die 10mm Kohle ist an der Belastungsgrenze, brennt schnell ab und hat die höchsterreichbare Kraterleuchtdichte, während die 12mm Kohle unterbelastet ist, langsam abbrennt und eine niedrigere Leuchtdichte hat.
.
Die Maßeinheit „Stilb"
Krater-Leuchtdichten werden in „Stilb" angegeben und liegen bei Reinkohlen zwischen 16.000 und 18.000 Stilb.
Eine Fläche hat dann die Leuchtdichte 1 Stilb, wenn sie je cm2 mit der Lichtstärke von 1 „neuen Kerze" (NK) strahlt (diese Lichtstärke wird „candela", abgekürzt „cd", genannt).
Jeder Versuch, die Kraterleuchtdichte durch Erhöhen der Betriebsstromstärke über den Wert 18.000 Stilb zu steigern, führt unweigerlich zu einem Zischen des Lichtbogens (Abb. 4).
Abb. 5
Beachten Sie daher bitte die auf die Kohlestifte aufgedruckten zulässigen Strombelastungen! Damit die Negativkohle, die in der Kinolampe als Lichtspender unbeteiligt ist, nicht langsamer abbrennt als die Positivkohle, wählt man ihren Querschnitt nur halb so groß wie den der Pluskohle, wodurch man gleichzeitig eine geringere Behinderung der Strahlung des Positivkraters erreicht.
Die beiden Kohlestifte brennen dann gleich schnell im „Abbrandverhältnis 1:1" ab. Die Negativkohle braucht keine Dochtkohle zu sein. Nur bei Durchmessern über 9mm kann es zweckmäßig sein, einen kleinen Dochtkanal mit Kohlenstoff-Füllung vorzusehen, der ein Wandern des Lichtbogens bei höheren Stromstärken verhütet.
.
Reinkohlenpaarung:
Wenn wir die bereits erwähnten Belastungswerte der Positiv-Reinkohlen (0,2 - 0,3 A/mm2) zugrundelegen, ergeben sich für die Negativstifte bei dem genannten halben Querschnitt Stromdichten von 0,4 - 0,6 A/mm2.
Diese unverkupferten Lichtkohlen lassen sich aber kaum mit mehr als 0,4 A/mm2 belasten, da sie sonst wegen des hohen elektrischen Widerstandes des Kohlematerials zu heiß werden und an der Oberfläche verbrennen. Man nennt diesen Vorgang „Verzundern".
Soll aber die Negativkohle Stromdichten bis 0,6 A/mm2 aushalten, so gibt man ihr einen Kupferüberzug. Kupfer ist bekanntlich ein guter Leiter und beseitigt schon in dünnen Schichten den störenden Spannungsabfall.
Eine hauchverkupferte Negativkohle kann mit Stromdichten bis 1 A/mm2 be= lastet werden. Da die sehr dünne Kupferhaut stets schon mehrere Millimeter hinter der glühenden Negativspitze abschmilzt und in kleinen Tropfen herabfällt, gelangt sie niemals in den Lichtbogen.
Die Kupferhaut bringt übrigens noch eine weitere Verminderung der Abbrandgeschwindigkeit, so daß man den Querschnitt einer verkupferten Negativkohle nicht größer als 173 des Pluskohlen- Querschnittes zu wählen braucht und damit das Abbrandverhältnis 1:1 erhält.
Die gebräuchlichsten Kohlenpaarungen für den Reinkohlen-Betrieb in Spiegellampen sind in folgender Tabelle aufgeführt.
.
RINGSDORFF-Niederintensitätskohlen für Gleichstrom
| Paarung | Paarung | |||
| Ampere | „Mira" | „Gamma S" | „Mira' | „Gamma S"verk. |
| 15-20 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| 18-24 | 11 | 8 | 11 | 6 |
| 22-28 | 12 | 9 | 12 | 6,5 |
| 26-32 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| 30-40 | 14 | 11 | 14 | 8 |
.
3. Was sind „Beckkohlen"?
Aus optischen Gründen, die wir Ihnen in Abschnitt 7 erläutern werden, ist die Verwendung von Reinkohlen bei Stromstärken von mehr als 50 Ampere zwecklos.
Zur Erzielung höherer Lichtströme dienen „Hochintensitätskohlen", die in Deutschland - nach ihrem Erfinder Heinrich Beck - auch „Beckkohlen" genannt werden.
Die Hochintensitäts- Positivkohle enthält einen verhältnismäßig großen Dochtkanal, der mit einer Mischung aus Leuchtsalzen und Kohlenstoff gefüllt ist.
.
Die Gruppe der "Seltenen Erden"
Ceritfluorid, ein Gemisch aus den Fluoriden einiger Elemente aus der Gruppe der Seltenen Erden, eignet sich besonders gut als Leuchtsalz. Die Seltenheit dieses Rohstoffes und die Notwendigkeit, ihn aus überseeischen Ländern einführen zu müssen, sind mit eine Erklärung dafür, daß Beckkohlen wesentlich teurer sind als die im vorigen Kapitel behandelten Reinkohlen.
Belastet man eine Beckkohle mit etwa 1-1,5 A/mm2 (das ist die 4-5fache Stromdichte der Reinkohle), so verdampft die Dochtmasse im Krater unter Bildung eines stark blauweiß leuchtenden Gasballs.
Die Leuchtdichte in Kratermitte beträgt - je nach Stromdichte - 50.000 bis 90.000 Stilb. (Sie werden sich erinnern, daß wir für Reinkohlen den Höchstwert von 18.000 Stilb nannten).
Hochintensitätskohlen erhalten in den meisten Fällen eine Außenverkupferung, da sie bei den üblichen Lampen und hohen Stromstärken andernfalls voll aufglühen und verbrennen würden.
Abb. 6 und Abb. 7
Abbildung 6 zeigt Ihnen den Schnitt durch eine solche Kohle. Wie sich der Beck-Krater vom Reinkohlen-Krater unterscheidet, läßt Abbildung 7 deutlich erkennen.
Rechts sieht man den durch den sogenannten Beck-Effekt entstehenden leuchtenden Gasball innerhalb des Kohlemantelringes, während der Reinkohlen-Krater bis zu den Rändern hin eine gleichmäßige Fläche aufweist. Im Gegensatz zur Reinkohle nimmt die Leuchtdichte des Beckkohlen-Kraters mit wachsender Stromdichte erheblich zu.
Eine Stromsteigerung bringt ferner eine wachsende Vertiefung des Kraters bei leichter Zunahme des Gasball-Durchmessers.
.
Abb. 8 und Abb. 9
Zur Ergänzung von Abb. 7, die den Unterschied des Reinkohlen- und Beckkohlen- Kraters zeigt, bringen wir in Abb. 9 noch Lichtverteilungskurven, aus denen deutlich zu erkennen ist, wie hoch die Leuchtdichte des Beckkraters in seiner Mitte ist und wie sie zu seinen Rändern hin abfällt.
Der Becklichtbogen - von einem rötlichen Flammensaum umgeben - zeigt im Gegensatz zum Reinkohlenbogen eine kräftige blauweiße Färbung. Hier wäre es schon eher berechtigt, von einem „Licht"-Bogen zu sprechen.
Bei Überlastung tritt kein „Zischen" ein. Der Krater wird zu tief, es zeigen sich Rußflocken, die Kraterleuchtdichte sinkt und die Abbrandgeschwindigkeit nimmt unbrauchbar hohe Werte an.
Die kleinste herstellbare Beckkohle von 4mm 0 (Belastung 15-20 A) wird nur in Einzelfällen in der Schmalfilmprojektion verwendet. Der für Normalfilm-Projektion durch die Ergebnisse der Praxis festgelegte Mindestdurchmesser von Beckkohlen ist 6 mm.
Abb. 10 - Das Abbrandverhältnis
Als Negativkohle verwendet man zur Beckkohle eine verkupferte Reinkohle, deren Durchmesser 1 bis 1,5 mm kleiner ist als der der Positivkohle.
Ein kleiner Dochtkanal mit Kohlenstoff-Füllung sichert den stabilen Ansatz des Lichtbogens an der Negativspitze.
Das Abbrandverhältnis beträgt bei den gebräuchlichen Beckkohlen-Paarungen 2:1 bis 4:1, das heißt: die Positivkohle brennt zwei- bis viermal so schnell ab wie die Negativkohle.
Das Abbrandverhältnis ist von der Stromdichte abhängig, mit der die Positivkohle belastet wird (Abb. 10). Während wir bei Reinkohlen mit einem Kohlenverbrauch von 50 bis 60 Millimeter pro Stunde rechnen, ergeben sich für die Beckkohle 4- bis 7mal so hohe Werte, nämlich 200 bis 400 mm/h.
Die Lichtbogenspannungen der Beckkohlen-Paarungen sind nicht konstant, wie bei den Reinkohlen. Die Werte bewegen sich zwischen 31 Volt bei 35 Ampere und 60 Volt bei 100 Ampere.
Hier ist eine Tabelle der gebräuchlichsten Beckkohlen-Paarungen für Stromstärken von 35 bis 75 Amp.:
.
RINGSDORFF-Hochintensitätskohlen für Gleichstrom
| Paarung | |||
| Ampere | Volt | „Sola Effekt" | „Gamma D" |
| 35-40 | 31-35 | 6 | 5 |
| 40-45 | 32-36 | 6,5 | 5,5 |
| 45-50 | 33-37 | 7 | 6 |
| 50-55 | 34-38 | 7,5 | 6 |
| 55-65 | 36-42 | 8 | 6,5 oder 7 |
| 65-75 | 43-50 | 9 | 7,5 oder 8 |
.
4. Was sind „Wechselstromkohlen" ?
Brennt man eine Reinkohlen-Paarung mit Wechselstrom, so bildet sich infolge der wechselnden Polarität weder ein Positivkrater noch eine Negativspitze.
Die Kohlen-Enden formen sich beide zu kleinen Kratern, die jedoch den Leuchtdichtewert eines Positivkraters bei weitem nicht erreichen.
Will man mit Wechselstrom ein einigermaßen brauchbares Licht erzeugen, so muß man Dochtkohlen verwenden, deren Kanal mit Effekt-Salzen (Leuchtsalzen) gefüllt ist. Diese geben dem Lichtbogen eine intensive Färbung und Leuchtkraft. Hier ergibt sich also ein wirkliches „Bogenlicht", das bei der Projektion als Lichtquelle dient (Abb. 11).
Abb. ll - Es gibt zwei Ausführungsarten
Es gibt zwei Ausführungsarten von Wechselstrom-Bogenlichtkohlen: Die ältere, heute kaum noch verwendete Effektkohle „Orion" mit kleinem Dochtkanal, und die moderne Type „Sola Duplex", eine Art Hochintensitätskohle mit großem Leuchtsalzdocht.
Orion=Kohlen werden mit 0,7 bis 0,8 A/mm2 belastet, Sola Duplex=Kohlen mit 1,5 bis 1,7 A/mm2. Eine „Negativkohle" gibt es bei einer Wechselstromkohlen-Paarung natürlich nicht.
Es werden vielmehr stets zwei gleiche Kohlentypen gleichen Durchmessers miteinander gepaart. Wechselstromkohlen werden grundsätzlich verkupfert geliefert und brennen im Verhältnis 1:1, also gleich schnell ab.
Der praktischen Anwendung von Wechselstrom-Bogenlicht stehen zwei Schwierigkeiten entgegen:
1. Der Lichtbogen schwankt, oder besser gesagt: „vibriert" im 50periodigen Rhythmus der angelegten Wechselspannung. Beim üblichen Bild-Wechsel von 24 Bildern/sec. erhält man dabei störende Lichtschwebungen.
Will man diese unterbinden, so muß man einen Frequenz-Umformer aufstellen, d. h. einen durch Drehstrommotor angetriebenen Generator, der einen z. B. 96-periodigen Wechselstrom erzeugt. Bei einer Periodenzahl, die ein Vielfaches von 24 ist, verschwinden die erwähnten Lichtschwebungen.
2. Die Lichtleistung des Wechselstrombogens reicht nur für ganz be schränkte Bildgrößen-Verhältnisse (kleinere Theater) aus. Die Anschaffung eines kleinen oder mittleren Gleichrichters - zur Erzeugung von Gleichstrom für Rein- oder Beckkohlen - dürfte kaum viel kostspieliger sein als die eines Frequenz-Umformers.
.
Wir nennen Ihnen hier die Paarungen der beiden Typen von Wechselstrom= Kohlen:
RINGSDORFF-Nieder- und Hochintensitätskohlen für Wechselstrom
| Ampere | „Orion" 0 mm | Ampere | „SolaDuplex"0 mm |
| 25-30 | 7x7 | 40- 50 | 6x6 |
| 30-40 | 8x8 | 50- 65 | 7X7 |
| 40-50 | 9x9 | 65- 80 | 8x8 |
| 50-60 | 10x10 | 80-100 | 9x9 |
| 60-70 | 11 xl 11 | 100-120 | 10 x10 |
.
5. Wie schaltet man Bogenlampen?
Man kann eine Reinkohlen-Paarung, die nach unseren Ausführungen in Absatz 2 etwa 50 Volt Spannung erfordert, nicht an die Klemmen einer Stromquelle von 50 Volt anschließen, um einen Lichtbogen zu erzeugen.
Dieser würde auf Grund seiner „negativen Charakteristik" nicht nur sehr unruhig brennen, sondern sogar dauernd wieder abreißen. Kein noch so vollkommener automatischer Nachschub wäre imstande, die Kohlen ihrer Abbrandgeschwindigkeit entsprechend so gleichmäßig vorzuschieben und so konstant auf der für 50 Volt passenden Bogenlänge zu halten, daß störungsfreies Brennen gewährleistet würde.
Nur eine Stromquelle mit „fallender Kennlinie" ermöglicht es, einen ruhigen Lichtbogen zu erzeugen. Das heißt: die Spannung der Stromquelle muß mit abnehmender Stromstärke (wenn der Kohlen-Abstand während des Abbrandes wächst) größer und mit zunehmender Stromstärke (z. B. beim Zünden) kleiner werden.
Man erreicht dies sehr einfach, indem man der Bogenlampe einen Widerstand vorschaltet, diesen also mit der Lampe in Reihe schaltet. Die Bezeichnung „Vorschaltwiderstand" oder „Beruhigungswiderstand" (weil er die Erzeugung eines ruhigen Lichtbogens möglich macht) wird Ihnen bereits bekannt sein.
.
Abb. 12
Wir zeigen Ihnen in Abbildung 12 als Beispiel ein Schaltschema, in dem eine 50 Volt- Bogenlampe an ein 220 Volt Gleichstromnetz angeschlossen ist. Der Wert R Ohm des vorzuschaltenden Widerstandes ist von der Stromstärke abhängig, mit der die Lampe brennen soll; er kann mit Hilfe des bekannten Ohmschen Gesetzes leicht errechnet werden.
Wir haben bei dieser Schaltung mit den gewählten Zahlenwerten zwar einen sehr ruhig brennenden Lichtbogen, gleichzeitig aber auch einen sehr unwirtschaftlichen Betrieb.
Im Widerstand R werden nämlich 170 Volt x 30 Ampere = 5.100 Watt nutzlos in Wärme umgewandelt, während der Lichtbogen selber nur 50 Volt x 30 Ampere = 1.00 Watt aufnimmt. Man wird also in der Praxis die Spannung der Stromquelle so klein wie möglich wählen, aber dennoch groß genug, um die beruhigende Wirkung des Vor-Widerstandes voll wirksam werden zu lassen.
Nach den Erfahrungen unseres Prüffeldes genügt es, wenn die Betriebsspannung etwa 50% größer ist als die Bogenspannung. Sie wäre bei Reinkohlen 50 + 25 = 75 Volt. Der Überschuß von 25 Volt am Widerstand R ergäbe nach obigem Beispiel nur noch einen Wärmeverlust von 25 Volt X 30 Ampere = 750 Watt.
Wollte man Becklicht direkt von einem 220 Volt Gleichstromnetz aus betreiben, so wäre die Unwirtschaftlichkeit noch viel größer, da Beckkohlen, wie in der Tabelle Absatz 3 erwähnt, bei den üblichen Stromstärken zwischen 40 und 65 Ampere nur 32-42 Volt erfordern.
.
Es gibt nur noch Drehstromnetze
Die früheren Gleichstromnetze der Städte sind inzwischen fast überall durch Drehstromnetze ersetzt worden und auch in den heute noch hier und da mit Gleichstrom versorgten Stadtteilen zum Aussterben verurteilt. Der benötigte Bogenlampen Gleichstrom muß daher an Ort und Stelle im Theater erzeugt werden. Die Umwandlung des vorhandenen Drehstromes in Gleichstrom kann auf 5 verschiedene Weisen geschehen. Es gibt:
- 1. Einanker=Umformer,
- 2. Motor=Generator=Aggregate,
- 3. Quecksilberdampf=Gleichrichter,
- 4. Trocken=Gleichrichter und
- 5. Glühkathoden=Gleichrichter.
Rotierende Umformer werden in Deutschland nur noch wenig gebraucht, während sie in den Theatern verschiedener Staaten des Auslandes viel verbreitet sind. Die Elektrotechniker des Kinofachhandels bevorzugen heute durchweg die Selen- und Glühkathoden Gleichrichter, die den früheren Quecksilberdampf-Typ verdrängten. Ihre Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit sind durch die Praxis erwiesen.
.
Die ferngesteuerten Gleichrichter
Bei den modernen, fernsteuerbaren Geräten kann man sogar auf den Spannung verzehrenden Vorwiderstand verzichten.
Ein Bogenlampen Stromkreis ohne Vorschaltwiderstand? Da Ihre diesbezügliche Frage nach den vorangegangenen Erläuterungen der Spannungs-Verhältnisse am Lichtbogen durchaus berechtigt wäre, geben wir Ihnen hier kurz eine entsprechende Aufklärung:
Die Spannung dieser ferngesteuerten Gleichrichter hat eine „fallende Kennlinie", d. h. ihre Spannung und die sie darstellende Kennlinie fällt mit zunehmender Stromstärke (Abb. 13). Ist das Gerät z. B. auf eine bestimmte Leerlauf Spannung, sagen wir z. B. auf 80 Volt eingestellt und wird die Lampe gezündet, so sinkt beim Zündkurzschluß im Stromkreis die Spannung auf einen minimalen Wert ab.
Werden die Kohlenspitzen dann voneinander entfernt, so stellt sich automatisch diejenige Bogenspannung ein, die eine bestimmte Kohlenpaarung bei der jeweils gegebenen Bogenlänge erfordert.
Wird dann der Lichtbogen während des Abbrandes länger, so steigt die Bogenspannung entsprechend, während die Stromstärke fällt. Umgekehrt aber sinkt die Bogenspannung und steigt die Stromstärke, wenn die Kohlen etwa infolge zu schnell laufenden Regelwerkes zusammenlaufen.
Bei verhältnismäßig niedrigen Stromstärken (Reinkohlen -Betrieb) benutzt man meistens Gleichrichter Typen ohne Fernregelung und ohne die „fallende Kennlinie", bei denen dann selbstverständlich der übliche Vorschaltwiderstand nicht fehlen darf.
.
6. Wieviel Licht braucht Ihre Bildwand?
Möglichst viel! Je mehr, desto besser!
Dieser Ausspruch eines Vorführers, der sich vergeblich bemühte, aus seinen alten Lampen mehr Licht herauszuholen, stimmt nicht! Ebenso wie ein zu dunkles Bild sehr unschön und nachteilig ist, kann nämlich auch ein zu helles Bild recht unangenehm wirken.
Zum besseren Verständnis der mit der Bildhelligkeit zusammenhängenden Fragen, möchten wir Ihnen zunächst einige allgemeine Aufklärungen über das Projektionslicht und seine meßtechnischen Begriffe geben.
Die auf der Bildwand durch das auffallende Projektorlicht erzeugte Beleuchtungsstärke wird mit einem Luxmeter gemessen. Ein solches Gerät besteht aus einem lichtelektrischen Element, das mit einem in „Lux" geeichten Millivoltmeter elektrisch verbunden ist.
Hält man das Element derart auf den zu messenden Bildschirm, daß ihre lichtempfindliche Fläche von den Lichtstrahlen des ohne Film laufenden Bildwerfers getroffen wird, so gibt der Zeiger des Instrumentes auf der Skala die Beleuchtungsstärke in Lux an.
.
„Lux" und „Candela" und „Apostilb"
(1 Lux ist diejenige Beleuchtungsstärke, die eine als lichttechnische Größe eingeführte Normalkerze „Candela" genannt, in 1 Meter Abstand erzeugt).
Die Helligkeit der vom Zuschauer betrachteten Bildwand hängt aber nicht allein von der Beleuchtungsstärke ab, sondern auch in nicht zu unterschätzendem Maße vom Reflexionsvermögen der Bildwand.
Ihre Farbe (grauverstaubt, gelblich oder schneeweiß), ihre Porosität, ihr Rückspiegelungsvermögen (eingelassene Glasperlen, Metallbelag) und der Betrachtungswinkel spielen für das in die Augen der Zuschauer zurückgestrahlte Licht eine große Rolle (siehe Abb. 15).
Um auch dieses Licht in Zahlen aus drücken zu können, führte man ein weiteres lichttechnisches Maß ein: die Leuchtdichte der Bildwand, deren Wert in Apostilb angegeben wird.
Stellen Sie sich dabei bitte vor, daß die vom Projektor angeleuchtete Bildwand ein eignes Licht ausstrahlt, nämlich das vom Beschauer wahrgenommene Reflexionslicht.
Dieses zurückgestrahlte Licht kann man nicht mit dem Luxmeter in so einfacher Weise messen, wie die Beleuchtungsstärke. Dagegen läßt es sich recht einfach errechnen, wenn der „Reflexionsfaktor" des Bildschirms bekannt ist (und dieser wird von den betreffenden Lieferfirmen angegeben).
Der „Reflexionsfaktor", multipliziert mit dem gemessenen Luxwert, ergibt die Bildwandleuchtdichte in Apostilb (abgekürzt asb).
.
Das Reflexionsvermögen
Das Reflexionsvermögen der Bildwand Ihres Theaters kann von Ihrem Fachhändler oder einem Ingenieur unseres technischen Kundendienstes auch mit Hilfe einer Bildwandprobe bestimmt werden. Eine solche Bildwandprobe enthält eine Reihe verschieden stark reflektierender Schirmproben, deren Reflexionsfaktoren bekannt sind.
Hält man eine solche Probe bei auffallendem Projektionslicht auf die Bildwand, so läßt sich die gesuchte Zahl durch Vergleich der betreffenden Bildwand mit den verschiedenen Proben genügend genau ermitteln.
Man bezieht dabei das Reflexionsvermögen auf das einer undurchlässigen, weißen Gipswand, der man den Reflexionsfaktor 1,0 zuteilt. Die Leuchtdichte oder Reflexionsfaktoren der bisher üblichen weißen Tonfilmwände haben dann im allgemeinen die Werte 0,8 bis 0,9; die neueren Spezialwände für Cinemascope und Breitbildvorführungen, metallisierte und Perlwände, erreichen die Werte 1,5 bis 2,5 oder mehr.
Beispiele:
a) Gemessener Luxwert auf der Bildwand = 100, ermittelter Reflexionsfaktor = 0,9,
zu errechnende Bildwandleuchtdichte =100 Lux X 0,9 = 90 Apostilb.
b) Gemessener Luxwert = 100 ermittelter Reflexionsfaktor = 2,0 zu errechnende Bildwandleuchtdichte = 100 Lux X 2,0 = 200 Apostilb.
.
Wieviel Apostilb sind nun wünschenswert?
Man hat - bereits zu Beginn der Farbfilm-Aera - festgelegt, daß die Bildwandleuchtdichte in den Filmtheatern möglichst 100-130 asb betragen soll. Im allgemeinen sind auch die Schwarzweiß-Kopien auf diese Werte abgestimmt.
Bildwandleuchtdichten über 130 asb sind auf alle Fälle zu vermeiden, da bei zu hellen Bildern unangenehmes und augenstörendes Flimmern auftritt. Diese Apostilb- Normalzahlen, die uns einen Anhaltspunkt für den benötigten Bildwerfer- Lichtstrom geben, gelten aber nur für die übliche Projektion im verdunkelten Theater.
Bei Tageslichtvorführungen, Freilichtprojektionen im Dämmerlicht oder Vorführungen in halberleuchtetem Saal sind nämlich höhere Leuchtdichtewerte erforderlich.
.
Der Lichtstrom
Es wird Sie nun interessieren, auch noch etwas über den Lichtstrom zu erfahren, der im vorigen Absatz zum ersten Male erwähnt wurde. Der Lichtstrom, in Lumen angegeben, ist das Produkt aus dem gemessenen Luxwert und der Quadratmeterzahl der vom Bildwerfer ausgeleuchteten Fläche, also: Lux x Bildfläche = Lumen.
Beispiel: Hat Ihr (4:3) Normalbild die Abmessung 5,5 X 4,0m = 22qm, und ergab die Messung der Beleuchtungsstärke 110 Lux, so beträgt der Lichtstrom 22 x 110 = 2420 Lumen.
Die Bildwerfer- Herstellerfirmen geben für ihre Lampen die erzielbaren Höchst-Lichtströme an (die sich stets auf 4:3 das Normalbildfenster beziehen); so daß Sie die Möglichkeit haben, die für eine bestimmte Projektion erforderliche Lampentype und Kohlenpaarung im voraus zu bestimmen oder die in Ihrem Theater vorhandenen Bildwerfer auf ihre Leistung und wirtschaftliche Ausnutzung durch Luxmessung zu überprüfen.
Wir geben Ihnen als Anhaltspunkte in der folgenden Tabelle Mittelwerte von Lichtströmen, die mit den gebräuchlichsten Reinkohlen= und Becklampen erzielt werden können (Spiegel- Durchmesser 250 bzw. 356 mm). Diese Zahlen sind nur als Richtwerte aufzufassen, da nicht nur die Leistungen
der einzelnen Lampen und die der Spiegel voneinander abweichen, sondern auch bestimmte Konstruktionseigenarten der einzelnen Bildwerfertypen, dazu Brennweite und Lichtstärke des Objektivs den Lichtstromwert beeinflussen.
.
Tabelle A
| Stromstärke | Durchschnitts-Lichtströme |
| A | in Lumen |
| Reinkohlenlicht | |
| 15-20 | 1200 |
| 25-30 | 1400 |
| 30-35 | 1800 |
| 40-45 | 2300 |
| Becklicht | |
| 35-38 | 2700 |
| 38-40 | 3100 |
| 40-42 | 3800 |
| 42-45 | 4500 |
| 48-50 | 5100 |
| 55-60 | 5800 |
| 60-65 | 6600 |
| 70-75 | 7400 |
.
Die genannten Lumenzahlen beziehen sich auf die 4:3 Normalbildfensteröffnung und sind bei laufendem Bildwerfer ohne Film gemessen. In der letzten Zeit sind nun neue Bildformate eingeführt worden, die den Lichtstrom der vorhandenen Bildwerfer nicht unwesentlich beeinflussen. Hier eine kleine Zusammenstellung der verschiedenen Bildfensteröffnungen:
.
Tabelle B
| Bildformat | Bildfenster- abmessung mm | Bildfenster- flache qmm | Vergleichs-Faktor | |||
| Normalbild 1 : 1,37 | 20,9 x 15,2 | 318 | 1,00 | |||
| Breitbild 1 : 1,66 | 20,9 x 12,6 | 264 | 0,83 | |||
| Breitbild 1 : 1,85 | 20,9 X 11,3 | 236 | 0,74 | |||
| CinemaScope_Lichtton | 21,3 x 18,2 | 388 | 1,22 | |||
| CinemaScope_Magnetton | 23,2 x 18,2 | 422 | 1,33 | |||
| SuperScope | 18,2 x 18,2 | 331 | 1.04 |
.
Infos zu den „Vergleichsfaktoren"
Um die Flächenverhältnisse zwischen den verschiedenen Bildfenstern deutlich erkennen zu lassen, haben wir in der letzten Tabellenspalte „ Vergleichsfaktoren" angeführt.
Diese geben an, um wieviel der ursprüngliche Normalbild-Lichtstrom nach Umstellung auf das betreffende neue Bildformat abnimmt oder zunimmt.
Zum Beispiel beträgt beim Breitbild 1:1,85 der Lichtstrom nur 0,74 seines ursprünglichen Wertes, während er beim Cinemascope- Magnetton-Bild 1,33 mal größer wird.
Auf diesem Wert fußt auch die nachfolgende Tabelle C, der Sie die erforderlichen Lichtströme für die Projektion der in Tabelle B aufgeführten Bildformate entnehmen können. Da bei der Projektion der verschiedenen Bildformate stets die gleiche Bildhöhe vorhanden sein soll, sind in der ersten Spalte der Tabelle C nicht die Bildbreiten, sondern die Bildhöhen angegeben.
Da es unter Umständen schwierig ist, die Bildhöhe in Ihrem Theater auszumessen, und damit Ihnen umständliches Rechnen erspart bleibt, geben wir Ihnen in Abb. 16 noch eine graphische Darstellung, aus der die zu jeder Bildbreite jeden Formates zugehörige Höhe ablesbar ist.
.
Hilfen zur Berchnung der erforderliche Lichtströme
Mit diesen rechnerischen Unterlagen ausgerüstet, dürfte es Ihnen jetzt ein Leichtes sein, die am Anfang dieses Abschnittes aufgeworfene Frage: „Wieviel Licht braucht Ihre Bildwand?" verhältnismäßig rasch zu beantworten.
Die Tabelle C übergehen wir hier, weil sie viel zu groß ist
Die erforderliche Lichtströme in Lumen für 100 Lux Beleuchtungsstärke in Bildmitte sind hier genau durchgerchnet, aber heutzutage icht mehr relevant.
.
Dennoch ein Rechenbeispiel : (gekürzt)
Angenommen, Sie möchten für Ihr Theater eine Cinemascope=Einrichtung beschaffen und feststellen, ob Ihre Lampen und die vorhandenen 50A Gleichrichter ausreichen.
Die Breite des 4:3 Normalbildes in Ihrem Theater sei 7,50m. Wir suchen nun in Abb. 16 zunächst die Bildhöhenzahl und finden 5,5 m.
Nach Tabelle C brauchen Sie für die Bildhöhe 5,5 (Spalte 1) beim Normalbild 4.150 Lumen, beim Cinemascope- Lichttonbild (Spalte 4) 5.820 Lumen, wenn die Beleuchtungsstärke in Bildmitte 100 Lux betragen soll.
Sollte Ihre Bildwand einen Reflexionsfaktor haben, der kleiner als 1 ist, so benötigen Sie mehr als 100 Lux und demnach auch einen entsprechend höheren Lichtstrom als die Tabelle angibt.
Sie kommen dann auf die gesuchten Werte, wenn Sie die abgelesenen Lumenzahlen 4150 und 5820 durch den Reflexionsfaktor dividieren. Das ergibt dann z. B. für einen Reflexionsfaktor von 0,9 = 4600 Lumen und 6500 Lumen
In Tabelle A auf Seite 20 werden Sie nun finden, daß man für 4.600 Lumen Normalbild- Lichtstrom ca. 45 Ampere Becklicht benötigt und daß man zur Erzeugung von 6.500 Lumen den Strom auf 60-65 Ampere erhöhen muß. Dieses Ergebnis würde bei den in unserem Beispiel gegebenen Voraussetzungen bedeuten, daß die 50 Ampere Gleichrichter nicht ausreichen.
Anstelle einer Neubeschaffung der Bogenlampen- Stromquelle oder evtl. sogar der Lampe selbst können Sie jedoch auch die Beschaffung einer Bildwand mit höherem Reflexionsvermögen erwägen.
.
7. Kennen Sie Ihre Spiegellampe?
Diese Frage mag Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, denn wenn Sie mit Ihrer Lampe täglich umgehen, wissen Sie doch recht gut, wie man die Kohlestifte einspannt und zündet, wie man den Spiegel verstellt und den Nachschub betätigt!
Aber - Hand aufs Herz! Wissen Sie auch, ob das Licht des Positivkraters so weitgehend wie möglich ausgenutzt ist? Sind Sie sich darüber im Klaren, wie das Licht der „Sonne" auf dem Bildfenster zustandekommt und welche optischen Regeln zu beachten sind, damit unnötige Lichtverluste vermieden werden?
Und gerade das ist es, das wir mit der obigen Frage zum Ausdruck bringen und in diesem Abschnitt erläutern möchten. Sollten Sie als alter, erfahrener Praktiker bereits mit diesen Dingen vertraut sein, um so besser!
Gestatten Sie uns jedoch dann, Ihnen verschiedene optische Kenntnisse und Erkenntnisse noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen.
.
Die Ausleuchtung des Bildfensters
Im Verhältnis zur Größe des Bildfensters stellt der leuchtende Positivkrater einer Kohlenpaarung eine ziemlich kleine Fläche dar, die zwecks vollkommener Ausleuchtung des Bildfensters optisch vergrößert werden muß.
Diese optische Vergrößerung kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen:
- durch eine Kombination von Sammellinsen (Abb. 18), wie es bis zum Jahre 1920 in der Kinoprojektionstechnik noch üblich war, oder
- mittels Hohlspiegel (Abb. 19) oder auch
- mit einer Kombination Hohlspiegel/ Sammellinse (Abb. 20).
In diesen wie auch in den weiteren Bildern dieses Abschnittes 7 sollen nicht etwa die Wege der Lichtstrahlen, sondern immer nur die von ihnen jeweils erfüllten Gebiete dargestellt werden.
.
Über das „Sammeln" des Lichtes
Das „Sammeln" des vom Krater ausgestrahlten Lichtes durch Linsen - auch „Kondensoren" genannt - hat den Nachteil, daß der in Abbildung 18 mit a bezeichnete Strahlungswinkel nicht sehr groß ist, ein wesentlicher Teil des Lichtes also nicht erfaßt wird.
Man könnte zwar die Lichtquelle näher an die Linse heranrücken, um dadurch den Strahlungswinkel zu vergrößern, aber die Praxis hat gezeigt, daß die - aus Konstruktionsgründen - dickglasigen Kondensorlinsen die hohe Temperatur des in nächster Nähe befindlichen Kraters nicht vertragen und nach kurzer Betriebsdauer zerspringen.
.
Der Linsenkranzabtaster des Emil Mechau
Der Konstrukteur des ersten Bildwerfers mit optischem Ausgleich, Emil Mechau, hatte diesen Mangel der Kondensor- Lampenhausoptik bereits 1910 erkannt und das Lampenhaus seines Bildwerfers mit einem Parabol-Spiegel, kombiniert mit einer Sammellinse, ausgerüstet.
Die Konstruktion des Mechau-Projektors war revolutionierend, wurde jedoch von der kinotechnischen Industrie in ihren Entwicklungsjahren zu wenig beachtet; man nahm damals den Hohlspiegel anscheinend zunächst als „Kuriosum" hin.
Erst die nach dem ersten Weltkrieg aus Heeres- Signalscheinwerfer- Beständen in großen Mengen anfallenden Kugelspiegel brachten findige Köpfe in den Reihen der Projektionstechniker auf die Idee, eine Spiegellampe zu entwickeln.
In den Filmtheatern der damaligen Nachkriegszeit bestand keineswegs ein „Mangel an Licht", da der geringe Nutzeffekt der üblichen Kondensorlampen durch hohe Stromstärken ausgeglichen wurde.
Reinkohlestifte von 20mm 0 und Stromstärken zwischen 60 und 80 Ampere waren durchaus keine Seltenheit. So war dann auch die Werbung für die neue Lampentype mit Hohlspiegel ganz eindeutig auf „Stromersparnis" eingestellt. Man kam jetzt mit 10-20 Ampere aus und erzielte dabei sogar ein etwas helleres Bild als zuvor.
.
Wie der Hohlspiegel funktioniert
Der Hohlspiegel entwirft auf dem Bildfenster eine scharfe vergrößerte Kraterabbildung. Der Krater ist aber kreisrund und das Bildfenster rechteckig. Zur vollen Ausleuchtung dieses Rechtecks muß nun - wie Abb. 21 zeigt - der Durchmesser des Kraterbildes mindestens so groß sein wie die Diagonale des Bildfensters, anderenfalls zeigt das Bild auf der Bildwand dunkle Ecken.
Die Praxis hat aber gezeigt, daß der Durchmesser der Kraterabbildung mindestens 30mm groß sein muß, wenn die Lampeneinstellung nicht gar zu empfindlich werden soll. Dabei beträgt dann der unvermeidliche Lichtverlust gut 50 Prozent.
.
Der Vergrößerungsfaktor einer Reinkohlen-Spiegellampe
Bei Reinkohlen zwischen 20 und 40 Ampere betragen die Kraterdurchmesser etwa 6 bis 10mm. Im Hinblick auf den eben erwähnten Abbildungsdurchmesser von 30mm müßte demnach der Vergrößerungsfaktor einer Reinkohlen-Spiegellampe gleich 5 bis 3 sein.
Dieser Vergrößerungsfaktor ist von folgenden Größen abhängig:
.
- 1. Von der Brennweite des Spiegels: je größer die Brennweite, desto kleiner die Kraterabbildung.
- 2. Vom Abstand zwischen Spiegel und Bildfenster: je kürzer der Abstand, desto kleiner die Kraterabbildung.
- 3. Von der Brennweite einer zusätzlichen Hilfslinse.
.
Zu Punkt 1 sei folgendes bemerkt: Es sieht zunächst aus, als ob es tatsächlich das Einfachste wäre, eine Kollektion Spiegel verschiedener Brennweiten zur Verfügung zu haben. Man könnte dann den für die jeweils gegebene Stromstärke bzw. Kratergröße günstigsten Spiegel auswählen.
.
Abb. 22
Als Beispiel zeigen wir in Abb. 22 im Schema den Strahlengang für zwei Spiegel verschiedener Brennweiten.
Der kleine Krater K1 wird mit dem kurzbrennweitigen Spiegel S1 auf dem Bildfenster genau so groß abgebildet wie der große Krater K2 durch den langbrennweitigen Spiegel S2.
Setzen wir bei beiden Kratern die gleiche Leuchtdichte voraus, so müßte die Abbildung des größeren Kraters K2 heller sein, wenn der Auffangwinkel a2 ebenso groß wäre wie a1 beim Spiegel kürzerer Brennweite.
Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn - wie aus Abbildung 23 deutlich ersichtlich - der Spiegel längerer Brennweite auch einen entsprechend größeren Durchmesser hat. Es dürfte in der Praxis weder zweckmäßig noch einfach sein, eine Lampe zu konstruieren, die mit Spiegeln verschiedener Durchmesser ausgerüstet werden kann, ganz abgesehen von finanziellen Erwägungen.
.
Jetzt die genaueren Details
Zu Punkt 2 zeigt Ihnen Abb. 24 die optischen Verhältnisse bei Veränderung des Abstandes zwischen Spiegel und Bildfenster. Zu jeder Entfernung b des Positivkraters vom Spiegel (die immer größer sein muß als die Spiegelbrennweite) gehört eine ganz bestimmte Entfernung a des Spiegels vom Bildfenster, bei welcher der Krater scharf abgebildet wird.
Verkürzt man den Abstand a1 zum Beispiel auf a2, so erhält man eine kleinere Abbildung auf dem Bildfenster als im Falle a1. Daraus folgt, daß eigentlich grundsätzlich bei höheren Stromstärken (größeren Kraterdurchmessern) der Abstand Spiegel-Bildfenster kleiner sein sollte als bei niedrigen Stromstärken.
Eine derartige Lampenverschiebung läßt sich jedoch nur bedingt ausführen und führt - optisch gesehen - nur in bestimmten Grenzen zu einem Erfolg. Bei aufmerksamer Betrachtung der Abbildung 24 werden Sie sicherlich festgestellt haben, daß die erwähnte Abstandsverkürzung infolge der Verschiebung des Positivkraters eine Verkleinerung des Auffangwinkels zur Folge hat.
So bleibt also die praktisch brauchbarste Lösung des Problems möglichst geringer Überstrahlung des Bildfenster- Ausschnittes die unter Punkt 3 genannte zusätzliche Hilfslinie (Abb. 25).
Ist diese eine Sammellinse, so verkleinert sie die Abbildung, ist sie aber eine Zerstreuungslinse, so vergrößert sie das Kraterbild. Eine Vergrößerung ist z. B. angebracht, wenn Beckkohlen sehr kleinen Durchmessers (6 bis 6,5 mm 0) verwendet werden.
Die lieferbaren "Hilfslinsen"
Die kinotechnischen Firmen liefern bereits seit längerer Zeit zu ihren jeweiligen Lampentypen geeignete Hilfslinsen, deren Brennweiten den anzugbenden Betriebsbedingungen angepaßt werden. Es muß aber hier auch darauf hingewiesen werden, daß eine zusätzliche Sammellinse automatisch den Öffnungswinkel des ins Projektionsobjektiv strahlenden Lichtkegels vergrößert und der Objektiv- Durchmesser groß genug sein muß, um das gesamte Licht aufzunehmen.
Besonders bei sehr kurzbrennweitigen Objektiven mit kleiner Hinterlinse kann diese überstrahlt werden, wie es als Beispiel in Abb. 26 dargestellt ist. Der hiermit verbundene Lichtverlust macht sich am Rand der Bildwand durch starken Helligkeitsabfall bemerkbar.
Abhilfe bringt in solchem Falle ein weiteres optisches Hilfsmittel, die sogenannte Bildfensterlinse, die sich direkt vor dem Bildfenster befindet und den aus dem Bildfenster zum Objektiv hin strahlenden Lichtkegel zusammenzieht.
Nach dem Studium dieses Abschnittes, der Ihnen hauptsächlich die Eigenschaften der Spiegeloptik näher brachte, dürften Sie jetzt Ihre Lampe wohl „richtig" kennen, so daß wir Ihnen in den folgenden beiden Kapiteln einige Tips für die richtige Bedienung der Spiegellampe geben können.
.
8. Wie brennt man Reinkohlen?
Die Abbrandgeschwindigkeit der Reinkohlen, deren besondere Eigenschaften bereits in Abschnitt 2 erläutert wurden, beträgt - je nach Belastung - 50 bis 60mm/h. Bei älteren Lampen finden wir heute noch die Handbedienung vor, die in gewissen Zeitabständen zum Nachstellen des länger gewordenen Lichtbogens betätigt werden muß.
Dieses Nachregulieren ist sehr sorgfältig vorzunehmen, wenn die Bildwandbeleuchtung während des ganzen Aktablaufes einwandfrei bleiben soll. Da sowohl Positiv- als auch Negativkohle während des Brennens in der Minute rund 1mm kürzer werden, wächst die Bogenlänge innerhalb einer Minute um 2mm.
Diese Verlängerung des Lichtbogens hat ein Ansteigen der Bogenspannung und ein Abfallen der Stromstärke zur Folge (siehe auch Abschnitt 5) und kann bei zu niedriger Gleichrichter- Grundspannung zum Abreißen des Lichtbogens führen. Es dürfte also zweckmäßig sein, bei Handbedienung den Kohlenabstand mindestens einmal in der Minute nachzuregulieren.
Kohleneinstellung
Die Grundeinstellung des Lichbogens sollte 4-5mm Länge nicht überschreiten, damit sich eine schlanke Negativspitze bildet, die dem Bogen eine stabile Führung gibt (Abb. 27).
Ein längerer Lichtbogen führt zu einer Abrundung der Negativspitze, die der Stabilität des Bogens undienlich ist. Bringt man die Kohlenstifte zu nahe aneinander, so entsteht an der Negativspitze ein pilzförmiges Gebilde, das dadurch zustandekommt, daß sich ein Teil der vom Positivkrater ausgehenden Kohlenstoff-Dämpfe auf der weniger heißen Negativspitze niederschlägt (Abb. 28).
Ein solcher Pilzkopf hindert die freie Ausstrahlung des Kraterlichtes zum Spiegel, und auf der Bildwand erscheint dann ein dunkler oder braungelber Flecken.
Für die gleichmäßige Ausleuchtung der Bildwand ist ferner sehr wichtig, daß die Kraterfläche nicht zur Seite, nach oben oder nach unten strahlt, sondern zur Spiegelmitte hin. Dies ist nur durch richtige Einstellung der Höhen= und Seitenverstellung der Negativkohle zu erzielen. Beachten Sie bitte hierbei, daß diese meist tiefer, also unterhalb der optischen Achse stehen muß, damit das erwünschte Geradebrennen des Positivkraters eintritt (Abb. 29).
.
Der Kohlen-Verbrauch und die Bogenlänge
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Kohlen-Verbrauch in gewissem Maße auch durch die Bogenlänge beeinflußt wird. Ein langer Bogen ergibt im allgemeinen eine etwas größere Abbrand- geschwindigkeit als ein kurzer Bogen bei gleicher Stromstärke.
Wenn Sie versuchen, ein „Zischen" des Lichtbogens und auch die Pilzbildung zu vermeiden, werden Sie allerdings die Feststellung machen, daß die Bogenlänge um so größer sein muß, je höher die betreffende Kohlenpaarung belastet wird.
Für die heute schon in überwiegender Mehrzahl verwendeten Reinkohlen-Lampen mit automatischem Nachschub gelten die gleichen Gesichtspunkte. Nur grob arbeitende, vielleicht ältere Anbau-Regelwerke, die in zu großen Zeitabständen reagieren bzw. falsch eingestellt sind, können die Ruhe des Reinkohlenlichtes sowie die Bildung eines geraden Kraters ungünstig beeinflussen.
.
Kondensorlampen in alten Dia-Projektoren
Eine Winkelstellung der Kohlestifte finden wir fast nur noch in den Kondensorlampen bestimmter Dia-Projektoren.
Die Kohlen müssen in solchen Lampen eine ganz bestimmte Stellung einnehmen, wenn der Lichtbogen zischfrei brennen und keine wesentliche Behinderung der Kraterstrahlung eintreten soll. Diese richtige Kohlenstellung zeigt Ihnen Abb. 30.
Steht die Negativspitze zu nahe am unteren Kraterrand (Abb. 31), so bildet sich eine die Kraterstrahlung behindernde obere „Nase" am Krater. Schiebt man die Negativspitze bis zur Kratermitte hoch (Abb. 32), so wird die Strahlung merklich behindert, außerdem ist der Lichtbogen dann wenig stabil.
Diese Bilder zeigen Ihnen übrigens auch die wesentliche Beeinflussung der Form der Negativspitze durch die Bogenlänge und Kohlenstellung.
Die Kraterprojektion als Life-Bild an der Wand
Die Zeiten, in denen man den Abbrand der Kohlestifte und die Bogenlänge durch das rote oder blaue Seitenfenster des Lampenhauses beobachtete, dürften endgültig vorbei sein. Man bedient sich jetzt ganz allgemein des „Kraterreflektors", d. h. eines optischen Systems, das die glühenden Kohlenspitzen auf einer Mattscheibe oder auf einer Wand des Bildwerferraumes vergrößert abbildet.
Befindet sich keine Mattscheibe am Lampenhaus, so befestigt man zweckmäßig eine weiße Karte in etwa Postkartengröße in der Nähe der Schauöffnung und projiziert den Lichtbogen mittels eines kleinen Spiegels oder eines Umlenkprismas an diese Stelle.
Zweckmäßig verwendet man einen für solche Zwecke geschaffenen Vordruck mit Fadenkreuz (Abb. 33 und 34), wie er von den Firmen des Kinofachhandels geliefert und auch von der Werbeabteilung der Ringsdorff-Werke kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
.
Abb. 33 - Die Kohlenstellung im Fadenkreuz
Bei horizontaler Kohlenstellung gibt die senkrechte Achse des Fadenkreuzes (Abb. 33) die Markierung für den Kraterrand an. Die Grenzlage der Negativspitze ist mit einem Bleistifte oder Federstrich zu kennzeichnen.
Wenn die Kohlenhalter gerade sind, was bei neuen und richtig zentrierten Lampen immer der Fall sein dürfte, dann erscheinen die Abbildungen der Kohlenspitzen immer auf der gleichen Stelle der Horizontalachse des Kreuzes.
Abweichungen kommen nur dann vor, wenn ungenaue Kohlensparer verwendet werden. Steht z. B. nach dem Wiederzünden der Lampe (nach Kohlenwechsel) das Bild des Positivkraters nicht mehr symmetrisch zur Horizontalachse, sondern etwas höher oder tiefer, so ist das ein Zeichen dafür, daß der Krater nicht mehr genau in der optischen Achse liegt. Der Spiegel muß dann in Höhenrichtung verstellt werden, wenn der Strahlenkegel konzentrisch um das Bildfenster fallen soll.
Bei Winkelstellung der Kohlen (Dia-Lampen) legt man im Projektionsbild auf dem Fadenkreuz den unteren Kraterrand am besten auf die Horizontalachse und den oberen Kraterrand auf die senkrechte Achse.
Steht dann die Negativspitze im Kreuz-Mittelpunkt, so hat man die in Abbildung 34 gezeigte günstige Kohlenstellung, bei welcher zwischen Kraterrand und Negativspitze ein rechtwinkliges Dreieck erscheint. Eine richtige, sinngemäße Anwendung des Kraterreflektors mit Fadenkreuz-Schirm sichert Ihnen einen einwandfreien Kohlenabbrand und eine gute gleichmäßige Bildausleuchtung.
.
Reinkohlen in Becklampen
Der Abbrand von Reinkohlen in ausgesprochenen Becklampen ist ohne jede Schwierigkeit möglich, wenn man das Nachschubverhältnis berücksichtigt. Während die meisten Becklampen eine variable Einstellung von 1:1 bis 1:5 besitzen, gibt es einige Typen, durch deren Spindel ein unveränderliches Nachschubverhältnis gegeben ist.
Es sind Werte zwischen 1:2 und 1:3 üblich. Für diese sind dann Reinkohlen bestimmter Paarungen erforderlich, die von den Lampenfabrikanten angegeben werden; sie sind auch in unseren Tabellen im Abschnitt 11 zu finden.
Im Reinkohlenbereich zwischen 35 und 45 Ampere ist es oft zweckmäßig, den für den Becklichtbetrieb vorgesehenen Blasmagneten abzuschalten bzw. kurzzuschließen, da die Stabilität des Bogens dann besser ist.
.
9. Wie brennt man Beckkohlen?
Grundsätzlich können Beckkohlen, deren Aufbau und Eigenschaften in Abschnitt 3 ausführlich erläutert werden, nur in Becklampen gebrannt werden.
Wir erwähnen dies ausdrücklich, weil in einzelnen Theatern hin und wieder Versuche gemacht werden, Reinkohlen-Lampen zur Hochintensitäts- Projektion zu benutzen. Warum geht das nicht?
.
Wir nennen Ihnen hier die Hauptgründe dafür:
- 1. Beckkohlen-Paarungen brennen nicht im Abbrand-Verhältnis 1:1, für das aber die Nachschubspindeln einer Reinkohlen-Lampe eingerichtet sind.
- 2. Der Becklichtbogen erfordert ein stabilisierendes Magnetfeld, das durch einen „Blasmagneten" erzeugt wird.
- 3. Der Vergrößerungsfaktor einer Reinkohlen-Lampe ist auf die verhältnismäßig großen Durchmesser der Reinkohlenkrater abgestimmt (siehe auch Abschnitt 7). Die Kratergröße der üblichen Beckkohlen reicht daher hier zur Bildfensterausleuchtung nicht aus.
- 4. Die Gehäuse der Reinkohlen-Lampen sind oft nur für Stromstärken bis zu 30 oder 40 Ampere berechnet und dürfen aus lüftungs- und wärmetechnischen Gründen nicht höher belastet werden.
- 5. In Reinkohlen-Lampen fehlt die zur Schonung des Spiegels erforderliche Zündschutzklappe.
.
Becklampen haben dagegen folgende Merkmale:
.
- 1. Der Nachschub ist automatisch (Motor-Antrieb). Das Nachschub-Verhältnis zwischen Positiv- und Negativ-Kohlenhalter liegt zwischen 2:1 und 3:1 oder es ist veränderlich einstellbar.
- 2. Ein Blasmagnet, meist hinter dem Spiegel angebracht, sorgt für die Stabilität des Beckbogens.
- 3. Der reichlich bemessene Abstand des Spiegels vom Bildfenster ermöglicht in Verbindung mit günstiger Spiegelbrennweite und zusätzlichen optischen Hilfsmitteln (Leuchtfeldlinse, Wabenkondensor) eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfensters.
- 4. Die Größe des Lampengehäuses läßt je nach Lampentype Stromstärken bis 75 oder 110 Ampere zu.
- 5. Eine Zündschutz-Klappe und gegebenenfalls auch eine Spiegelschutz-Scheibe verhüten Spiegelbeschädigungen beim Zünden mit hohen Stromstärken.
- 6. Eine Gabelauflage für die im Positivhalter schwenkbar angeordnete Positivkohle sichert bei einwandfreier vorheriger Zentrierung die richtige Lage des Positivkraters in der optischen Achse.
.
Sinn und Zweck des Blasmagneten
Bevor wir nun auf die Becklicht-Projektion näher eingehen, wollen wir Ihnen noch den Sinn und Zweck des unter Punkt 2 erwähnten Blasmagneten erklären:
Jeder von einem elektrischen Strom durchflossene Leiter ist von einem konzentrischen magnetischen Feld umgeben, also sind es auch bei brennendem Lichtbogen die Kohlestifte (Abb. 35).
Der Lichtbogen selbst aber ist ein „beweglicher" elektrischer Leiter (Anmerkung : siehe hierzu "Was ist ein Plqsma ?"), der nicht nur gegen Luftzug empfindlich ist, sondern auch durch ein magnetisches Feld abgelenkt werden kann.
Sie können sich hiervon leicht überzeugen, wenn Sie dem Bogen die Pole eines Hufeisenmagneten nähern. Machen Sie bitte dieses Experiment aber nicht ohne Spezialbrille (Schweißerbrille), da die im Lichtbogen enthaltenen ultravioletten Strahlen Augenentzündungen verursachen können.
Innerhalb der üblichen Stromstärken bis 35 Ampere übt das Magnetfeld auf einen Reinkohleribogen keinen störenden Einfluß aus. Der Beckbogen reagiert aber bei höheren Stromstärken über 40 Ampere sehr empfindlich auf magnetische Ablenkungen.
Die in Abb. 35 dargestellten magnetischen Kraftlinien drücken den Beckbogen in Richtung des Positiv-Kraters, so daß er über den Kraterrand auf den Mantel der Positivkohle übergreift.
Zur Bildung des leuchtenden Gasballs im Krater muß aber der Bogenansatz am Kraterrand liegen. Es ist die Aufgabe des Blasmagneten, das vorhandene Störfeld zu neutralisieren und damit die Bogenflamme aufzurichten.
In den Abbildungen 36-38 zeigen wir Ihnen die Anordnung des Blasmagneten bei verschiedenen Lampentypen.
.
Zentrieren!
Die richtige Bedienung einer Becklampe ist keineswegs - wie von Nichtkennern meist angenommen wird - besonders schwierig. Es sind nur einige wenige bestimmte Dinge zu beachten, auf die wir hier ausführlich eingehen.
Mit Becklampen kann man nur dann eine befriedigende Bildausleuchtung erzielen, wenn die Lampen richtig zentriert sind, das heißt, wenn die Mitten des Spiegels und der Positivkohle in der optischen Achse des Bildwerfers liegen.
Abb. 39
Abb. 39 zeigt das Schema einer Becklampe, bei der die Auflagegabel für die Positivkohle zwar richtig, der Positivkohlenhalter aber zu hoch steht.
Was ist die Folge dieser falschen Halterjustierung? Wenn die Pluskohle in ihrer vollen Länge eingespannt wurde und die Kratervergrößerung auf dem Bildfenster mittels der Spiegel-Stellschrauben zentriert ist, wird die Bildausleuchtung einwandfrei sein. Je mehr sich dann aber der Pluskohlenhalter während des Kohlenabbrandes der Auflagegabel nähert, desto tiefer sinkt der Krater unter die optische Achse, so daß der von ihm ausgehende Lichtkegel allmählich vor dem Bildfenster aufwärts wandert und an der oberen Bildwandkante die berüchtigten „gelben
Ecken" erscheinen.
Man muß dann während der Vorführung immer wieder die Höheneinstellung des Spiegels korrigieren. Setzt man nach Zurückschieben des Positivhalters in seine Anfangsstellung neue Kohlestifte ein, so muß man den inzwischen in „Tiefstellung" gedrehten Spiegel erst wieder hochdrehen, damit das Bild beim neuen „Start" am unteren Rand keine gelben Ecken bekommt.
Ebenso fehlerhaft und für die Lampenbedienung umständlich ist es, wenn der Positivkohlenhalter gegenüber der Gabelauflage zu tief steht und der Krater dann während des Abbrandes aufwärts wandert. Hierbei besteht außerdem noch die Gefahr, daß die Kohle mit ihren letzten 10 bis 15 Zenti= metern klemmt und abbricht.
.
Bildverfärbungen
Absolut genaue Zentrierung einer Becklampe, mag diese Arbeit auch etwas Geduld und Zeit erfordern, ist also wesentlich. Sie bedeutet auch eine große Erleichterung für die Überwachung der Ausleuchtung.
Bei falschem Abstand des Positivkraters vom Spiegel entstehen bei der Becklichtprojektion die gefürchteten „Bildverfärbungen".
Durch die bei allen Becklampen vorgesehene Seitenprojektion ist es nun möglich, die richtige Entfernung des Kraters vom Spiegel auf einer Mattscheibe oder auf einem Fadenkreuzschirm zu fixieren. Es bleibt dann nur noch die Aufgabe, die Geschwindigkeit des automatischen Regelwerks so einzustellen, daß der Positivkrater während des Abbrandes stets das festgelegte Markierungszeichen berührt.
Läuft der Vorschub der Positivkohle zu langsam, so vergrößert sich nach und nach der Abstand des Kraters vom Spiegel, und es erscheint auf der Bildwand, vom Spiegel auf dem Bildfenster abgebildet, der blauviolette Lichtbogen. Diese Verfärbung der Bildmitte ist also eine Folge des Zurückbleibens der zu langsam vorrückenden Positivkohle (Abb. 41).
Nähert sich andererseits der Positivkrater infolge zu raschen Laufs des Nachschubs nach und nach dem Spiegel, so wird ein Teil des gelbweiß leuchtenden Kraterrandes auf dem Bildfenster abgebildet (Abb. 42). Diese falsche Kraterstellung macht sich auf der Bildwand durch gelbe Flecken bemerkbar.
.
Bogenlänge und Bogen-Zündung
Die Bogenlänge sollte grundsätzlich 1/10 der Stromstärke, aber nicht kleiner als 4 mm und nicht größer als 8 mm sein. Es sei auch noch besonders darauf hingewiesen, daß das Becklicht gegen plötzliche Veränderungen der Bogenlänge empfindlich ist.
Längt sich z. B. der Bogen (etwa infolge einer Hemmung des Regelwerks), so sinkt nicht nur die Leuchtkraft des Positivkraters erheblich, sondern es verschlechtert sich gleichzeitig auch die Bildausleuchtung, weil dabei der Durchmesser des Gasballes zwangsläufig kleiner wird.
Es ist jedenfalls angebracht, in solchen Fällen die zurückgebliebene Kohle nicht ruckartig, sondern langsam wieder in ihre richtige Stellung zu bringen, damit sich der ursprüngliche Gasball allmählich neu bilden kann und ein stoßartiges Aufhellen des etwas dunkler gewordenen verfärbten Projektionsbildes vermieden wird.
Ein durch Zusammenlaufen der Kohlen zu kurz gewordener Lichtbogen bringt in Becklampen die Gefahr der Rußbildung. Diese muß unter allen Umständen vermieden werden, weil die schwarzen Rußflocken sich auf dem oberen Viertel des Spiegels niederschlagen und dieser Spiegelbezirk dann besonders viel Strahlungswärme speichert. Die Folgen sind aber schädliche Spannungen im Glas des Spiegels, die ihn leicht zum Springen bringen können.
.
Die Sprache : richtig, "richtiger", "am richtigsten"
Man muß daher einen Beck-Bogen in anderer Weise zünden als man es vielleicht von der Reinkohlen=Lampe her gewöhnt ist. Besonders bei hohen Betriebsstromstärken (50 bis 65 Ampere) ist es erforderlich, die Negativ= kohle, mit der man zweckmäßig zündet, sofort nach der zündenden Berüh= rung wieder in ihre normale Stellung zurückzubringen und nicht etwa mehrere Sekunden lang die Kohlenspitzen auf knapp 1 mm Entfernung stehenzulassen.
Noch "richtiger" ist es, am Vorwiderstand oder Gleichrichter schon vor dem Zünden eine niedrigere Stromstärke einzustellen und sie erst nach dem Zünden auf den normalen Wert zu bringen. Dort, wo Gleich= richter mit Fernsteuerung zur Verfügung stehen, ist das auch schon all= gemein üblich geworden.
.
Beck-Winkellampen bis 150 Ampere
Es gibt auch Becklampen, bei denen die Positiv- und die Negativkohle nicht in axialer, sondern in Winkelstellung angeordnet sind. Diese „Winkellampen" sind für Stromstärken bis zu 150 Ampere bestimmt und erfordern bei der Höheneinstellung der Negativkohle besondere Aufmerksamkeit.
Steht nämlich ihre Spitze zu tief, so umhüllt die Lichtbogenflamme den unteren vorderen Teil der Positivkohle („Untergriff"). Der Krater wird flach und seine Leuchtdichte gering.
Steht die Negativkohle aber zu hoch, so wird der Lichtbogen unruhig. In beiden Fällen brennt der Positivkrater schief. Abbildung 43 zeigt einen 125 Ampere-Bogen bei drei verschiedenen Stellungen der Negativkohle.
Lampen-Lüftung
Wir möchten nicht versäumen, Ihnen auch etwas über die Lüftung der Lampenhäuser bei Becklicht-Betrieb zu sagen.
Jeder elektrische Lichtbogen; ganz gleich, ob es sich um Rein- oder Beckkohlen handelt, erzeugt kleine Mengen Stickoxyd und Kohlenoxyd, d. h. Gase, deren Einatmen in großen Mengen gesundheitsschädlich ist.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde muß laut polizeilicher Vorschrift in einem Bildwerferraum jedes Lampenhaus mit einem Abzugsrohr versehen sein, das ins Freie führt. Eine schlechte Absaugwirkung des betreffenden Rohres läßt sich bei Reinkohlen mit dem Auge nicht feststellen, weil die genannten Gase farblos und daher unsichtbar sind.
Bei Becklicht dagegen meldet ein aus dem Lampengehäuse dringender blauer Qualm eine schlechte Lüftung an. Dieser bläuliche Rauch enthält u. a. die Verbrennungsprodukte der im Krater verdampfenden, durch die aufsteigende heiße Luft mitgerissenen Leuchtsalzteilchen.
Diese sind ganz ungefährlich, also nicht giftig, wie vielfach behauptet wird, aber lästig, weil sie sich im Laufe der Zeit an den Wänden des Bildwerferraumes; an den Maschinenteilen und natürlich auch im Ton-Verstärker niederschlagen und dort einen weiß-blauen Belag bilden können.
Es ist demnach wichtig, daß die Abzüge gut funktionieren, ohne aber dabei einen so starken Luftzug in der Lampe zu erzeugen, daß die Ruhe des Lichtbogens gefährdet ist.
In gewissen Fällen kann es daher zweckmäßig sein, im Abzugskamin einen Regelschieber einzubauen, falls er nicht schon im Abzugsstutzen des Lampenhauses vorgesehen ist.
.
Zuammenfassung :
Zum Schluß dieses Abschnittes sei noch einmal kurz zusammengefaßt, auf welche Dinge Sie Ihr besonderes Augenmerk richten müssen, wenn Sie auf einfache Bedienung Ihrer Becklampen und einwandfreie Bildwandbeleuchtung Wert legen:
- 1. Lampe tadellos zentrieren.
- 2. Regelwerk sorgfältig auf die Abbrandgeschwindigkeiten der verwendeten Kohlestifte einstellen und im Laufe der Zeit auch gut pflegen, damit keinerlei Hemmungen des Nachschubs durch zu schwer gehende Spindeln eintreten können. Der Erwärmung ausgesetzte Gewindespindeln nicht ölen und nicht mit Fett einschmieren. Nur Graphitpulver oder die von der Herstellerfirma und dem Fachhandel empfohlenen Schmiermittel verwenden.
- 3. Kohlenpaarungen so auswählen, daß die gegebene Gleichrichterleistung auch für die auf der Positivkohle aufgedruckte Stromstärke ausreicht.
- 4. Kohlestifte nicht feucht lagern.
- 5. Stromstärke vor dem Zünden wenn möglich etwas reduzieren und den Zündvorgang selbst (das Berühren der beiden Kohlen) so kurzzeitig wie möglich halten.
.
10. Ist Becklicht „blau"?
Da Sie, lieber Leser, vielleicht auch zu denjenigen Theaterbesitzern oder Vorführern zählen, die das Becklicht als stark „blaustichig" empfinden, möchten wir nicht versäumen, auch noch auf dieses recht umstrittene Thema einzugehen.
Wenn Sie durch die Schauöffnung Ihres Bildwerferraumes auf die mit Reinkohlenlicht beleuchtete Bildwand blicken, wird Ihnen, solange der Bildwerferraum von Tageslicht erhellt ist, das Bild „gelbstichig" erscheinen.
Wenn der gleiche Raum dagegen abends nur von Glühlampen beleuchtet ist, scheint Ihnen das Schirmbild „weiß" zu sein. Sie denken wahrscheinlich, wie viele Vorführer, die diese Beobachtung auch schon gemacht haben, das Bild sei abends heller, weil dann die Netzspannung höher sei. In Wirklichkeit aber beruht diese Erscheinung auf einer optischen Täuschung. Abends sind unsere Augen für Lichteindrücke empfindlicher als tagsüber.
.
Beurteilung von Farben aus dem Bildwerferraum
Auch bei der Beurteilung von Farben vergleichen wir diese unwillkürlich mit den Farben der Umgebung. So sehen am Abend die Augen bei einem Blick durch die Schauöffnung die Farbe des von der Bildwand reflektierten Lichtes immer im Vergleich mit der Beleuchtung des Vorführraumes, die bei Glühlampenlicht wesentlich „gelblicher" aussieht als das Licht des Reinkohlenkraters. Das Ergebnis ist, daß die Bildwand schneeweiß erscheint.
Ersetzen wir aber die Glühlampen z. B. durch moderne Leuchtstoffröhren; die ein bläulich-weißes Licht ausstrahlen, so werden die Augen das gleiche mit Reinkohlen projizierte Bild auf der Bildwand als „gelbstichig" empfinden.
Auf diesen Tatsachen beruhen alle Beobachtungen über die Farbe des Becklichtes. Blickt man durch die Schauöffnung eines durch Tageslicht oder Leuchtstoffröhren erhellten Bildwerferraumes auf das mit Becklicht beleuchtete Bild, so zeigt sich uns dieses Bild fast reinweiß, da die spektrale Zusammensetzung des Becklichtes der des Tageslichtes oder der Leuchtstoffröhren ähnlich ist.
Das gleiche Bild sieht aber sofort blaustichig aus, wenn der Bildwerferraum mit Glühlampen beleuchtet wird.
Beurteilung von Farben aus dem Zuschauerraum
Diese Regel, daß unsere Augen unbewußt Vergleiche ziehen, wenn sie eine Farbe beurteilen, und daß dabei bestimmte Farbempfindungen ausgelöst werden, gilt auch für den Zuschauerraum.
Dieser, wie auch die Vorräume des Theaters, sind meistens mit elektrischen Glühbirnen ausgerüstet. Der Beobachter im Saal wird dann nach Verlöschen des gelblichen Lichtes eine Becklichtprojektion bei Beginn des Filmes sehr leicht als bläulich empfinden.
Dieser Eindruck verliert sich jedoch nach kurzer Zeit, wenn nicht gerade in der Nähe der Bildwand augenfällige rote Notbeleuchtungskörper dem Auge eine dauernde Vergleichsmöglichkeit bieten.
Bei der modernen Theatergestaltung werden heute, wenigstens in den Vorräumen, schon sehr viel die blauweiß strahlenden Leuchtstoffröhren benutzt, während die Säle noch vorwiegend mit Glühlampen beleuchtet werden. Hier könnte im Falle von Becklichtprojektion ein Auswechseln der normalen Glühbirnen durch hellblau gefärbte sogenannte „Tageslichtlampen" eine Verbesserung bringen.
.
Unsere Augen und die „Farbtemperatur"
Wie Sie aus den vorstehenden Ausführungen ersehen, ist das menschliche Auge nicht in der Lage, über die Farbe des Projektionslichtes ein objektives Urteil abzugeben.
Man hat jedoch eine Methode gefunden, den Rot- oder Blauanteil des Lichtes einwandfrei physikalisch zu bestimmen, indem man die „Farbtemperatur" der Lichtquelle mißt.
Diese „Farbtemperatur", die man in „Kelvin"-Graden (°K, das ist die betreffende Temperatur in °C, vermehrt um 273° C) angibt, wird im physikalischen Laboratorium wie folgt gemessen:
Man vergleicht die zu untersuchende Lichtquelle mit einem „schwarzen Körper", dessen Glühtemperatur man so weit erhöht, bis seine Farbe mit der Farbe der Lichtquelle übereinstimmt. Die gemessene Glühtemperatur des schwarzen Körpers ist dann die „Farbtemperatur" der untersuchten Lichtquelle. Eine Lichtquelle enthält einen um so größeren Anteil an blauen Strahlen, je höher ihre Farbtemperatur ist.
In der nachfolgenden Tabelle geben wir Ihnen die Farbtemperaturen in °K der bekanntesten Lichtquellen an, um Ihnen zu zeigen, daß Becklicht noch lange nicht so blaustichig ist, wie unser gewohntes Tageslicht.
.
| Lichtquelle | Farbtemperatur etwa |
| Glühlampe....... | 2400°-3000° K |
| Reinkohle-Krater..... | 3500°-4000° K |
| Sonnenlicht....... | 4800 °K |
| Beckkrater....... | 5000° -6500° K |
| Bedeckter Himmel ca..... | 6500 °K |
| Klarer blauer Himmel ca. | 12000°K |
.
Sie ersehen aus dieser Tabelle, daß Becklicht entsprechend seiner höheren Farbtemperatur - sie ist rund zweimal so hoch wie die der normalen Glühlampe und etwa 70% höher als die des Reinkohlekraters - wesentlich mehr Blau enthält als diese beiden Lichtquellen. Von einem störenden Blau kann aber nur dann die Rede sein, wenn die Lampe nicht richtig eingestellt ist, das Bild dunkel und violett wird oder das Auge infolge schlechter Zentrierung die Vergleichsmöglichkeit mit „gelben" Rändern und Flecken hat.
.
11. Welche Kohlenpaarung braucht Ihr Bildwerfer?
Die ausführlichen Darlegungen und Tabellen in Abschnitt 6 „Wieviel Licht braucht Ihre Bildwand?" dürften Sie schon in die Lage versetzt haben, zu beurteilen, ob Sie für Ihre Projektionsverhältnisse Rein- oder aber Beck- Kohlen verwenden müssen.
Auf Grund der in Tabelle A auf Seite 20 angegebenen Lumenzahl konnten Sie sich auch schon für einen gewissen Stromstärkebereich entscheiden. Die zugehörigen Kohlen-Durchmesser finden Sie nun in den umstehenden Tabellen, die wir kurz erläutern möchten.
Die Ihnen gebotene Auswahl wird nämlich auf den ersten Blick hin so groß erscheinen, daß ein „Führer durch Marken und Dimensionen" nur willkommen sein dürfte.
.
a) Reinkohlen
Für den Reinkohlenbetrieb, der bei günstiger Anpassung aller optischen Hilfselemente rund 2.000 Lumen sichert, empfehlen wir die Paarung unserer Positivkohle „Mira" mit einer hauchverkupferten Negativkohle „Gamma S". Die Vorteile einer Negativkohle mit Außenverkupferung sind folgende:
- 1. Kein nennenswerter Spannungsabfall längs des Kohlestiftes.
- 2. Einwandfreier, sicherer Kontakt am Einspannende.
- 3. Keine Kupfertropfen im Lichtbogen, welche die Bogenspannung und den Bogenstrom ungünstig beeinflussen könnten.
- 4. Der kleine Durchmesser der „Gamma S" bringt in Verbindung mit einer schlanken Spitze die geringste Behinderung der Kraterstrahlung.
.
b) Beckkohlen
Erfordert Ihre Bildwand mehr als 2.500 Lumen, so ist die Anwendung von Hochintensitätskohlen, also von Becklicht, nicht zu umgehen. Im allgemeinen werden Sie mit unserer Standard-Paarung „Sola-Effekt" und „Gamma D" die beste Lichtwirkung und Ausleuchtung erzielen. Sie müssen nur darauf achten, daß die in der nachstehenden Tabelle IV genannten, auch auf die Positivkohlen aufgedruckten Strombelastungen nicht unter- oder über-schritten werden.
Bei zu niedriger Belastung setzt nämlich der Beckeffekt periodisch aus und die Bildausleuchtung wird unbefriedigend. Bei zu hoher Stromstärke steigt zwar die Kraterleuchtdichte noch etwas über den normalen Wert an, aber der Lichtbogen brennt dann am Beginn der Rußflockenbildung, und der sehr hohe Abbrandwert steht dann zum Lichtgewinn in keinem vernünftigen Verhältnis mehr.
.
c) Spezial-Beckkohlen für Hochstromlampen
Becklampen-Stromstärken über 80 Ampere werden nur in sehr großen Theatern und Freilicht-Projektionen angewandt und erfordern nicht nur besonders geeignete Lampen, sondern auch Spezial-Kohlen.
Abbildung 43 zeigt Ihnen einen 125-Ampere Beckbogen bei stumpfwinkliger Anordnung der Kohlestifte. Lange Zeit war es nicht möglich, bei der bekannten axialen Kohlenstellung einen einwandfreien Beckeffekt zu erzielen, wenn die Stromstärke 80 A überschritt. Die hierbei auftretenden Unstabilitäten des Bogens waren nicht nur auf das bei hohen Strömen entsprechend stärker anwachsende magnetische Störfeld zurückzuführen, sondern auch auf besondere Eigenschaften des Bogen-Ansatzes an der Negativ- Kohlenspitze.
Nachdem heute nun eine Reihe geeigneter Hochstromlampen zur Verfügung steht und seitens der Lichtkohlen-Industrie die brenntechnischen Probleme mittels Spezial-Beckkohlen gelöst wurden, bereitet die axiale Kohlenstellung auch bei hohen Strömen keine Schwierigkeiten mehr.
.
d) Wechselstrom=Effektkohlen
Für die selten angewandte Projektion mit Wechselstromlampen stehen Ihnen zwei Kohlemarken zur Verfügung, die sich hauptsächlich durch ihre Lichtleistung und Abbrandgeschwindigkeit unterscheiden.
Die Niederintensitätskohle „Orion" (sie ist, wie die Gattungsbezeichnung schon sagt, für niedrige Querschnittsbelastung bestimmt) gleicht in Bezug auf Abbrandgeschwindigkeit den Reinkohlen. Die Hochintensitätskohle „Sola Duplex" ist dagegen eine Wechselstrom- Beckkohle und fordert eine Speziallampe mit automatischem Nachschub.
.
12. Haben Sie noch eine Frage?
In den vorstehenden elf Kapiteln haben wir Ihnen elf wichtige Fragen eingehend beantwortet; wir glauben daher, daß Sie nun mit verschiedenen lichttechnischen Dingen, die Ihnen bisher vielleicht problematisch erschienen, vertraut wurden.
Jedoch nehmen wir an, daß Sie noch diese oder jene weitere Frage an uns richten möchten, sei es, daß Sie hier oder dort noch eine kleine Unklarheit sehen, oder daß in Ihrem Theater vielleicht besonders schwierige Verhältnisse herrschen. Wir möchten betonen, daß wir immer gern bereit sind, Sie und Ihren Fachhändler in jeder Weise zu unterstützen und zu beraten.
Unsere Außenbüros und Vertreter sowie die Herren unseres technischen Außendienstes stehen Ihnen zu jeder Zeit zur Verfügung und bringen Ihren Fragen und Wünschen großes Interesse entgegen.
.
Unsere Hausmitteilungen „Der Lichtbogen"
Eine weitere Möglichkeit, sich über laufende mit dem Bogenlicht zusammenhängende Probleme zu informieren, bieten Ihnen unsere Hausmitteilungen „Der Lichtbogen", die Ihnen auf Wunsch kostenlos zugesandt werden.
Mit diesen kleinen, etwa 16 Seiten umfassenden illustrierten Heften möchten wir Ihnen in Ergänzung unseres Handbuches mit weiteren guten Ratschlägen und praktischen Winken zur Hand gehen, denen die gesamten Forschungsarbeiten unseres Lichtkohlen-Prüffeldes und die Erfahrungen der Ingenieure unseres Außendienstes zu Grunde liegen.
„Der Lichtbogen" unterrichtet Sie auch über Weiterentwicklungen und Neuerungen und ermöglicht Ihnen eine Mitarbeit, indem Sie uns Ihre speziellen Erfahrungen und Beobachtungen lichttechnischer Art wissen lassen. In einer Sonderspalte „Sie fragen, wir antworten" gehen wir ausführlich auf besondere Feststellungen und Fragen unserer Leser ein.
.
.