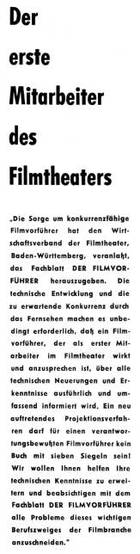Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 1 - 1954 - geparkt
Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.
Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.
.
Verbesserte Bildausleuchtung mit Bauer-Leuchtfeldlinsen
(das war verdeckte Werbung 1954)
Bei den Kinoprojektoren mit Spiegelbogenlampen ist die eigentliche Lichtquelle für die Projektion der Krater der Pluskohle (bei Reinkohlen) oder der im Pluskohlenkrater schwimmende Gasball (bei HI-Kohlenstiften). Dieser Gasball wird vom Bogenlampenspiegel vergrößert am Bildfenster scharf abgebildet.
Der Konstrukteur einer Bogenlampe ist nun bemüht, die Abbildung des Kraters so groß zu machen, daß die Bildfensteröffnung gerade ausreichend ausgeleuchtet wird.
Ist die Kraterabbildung am Bildfenster nämlich zu groß, so bedeutet das einen erheblichen Lichtverlust, weil von der großen Lichtsonne ja nur derjenige Teil zur Projektion nutzbar gemacht werden kann, den der Bildfensterausschnitt herausgreift.
Ist umgekehrt die Abbildung am Bildfenster zu klein, so wird die Bildfenstermaske nicht mit genügend großer Gleichmäßigkeit ausgeleuchtet. Auf der Leinwand zeigen sich starker Randabfall und bei Becklicht unter Umständen farbige Bildecken.
.
Möglichkeiten, die Größe des Bildfenster-Lichtkreises zu verändern.
Die vollkommenste Ausnutzung des vom Bogenlampenspiegel abgestrahlten Lichts hat man also dann, wenn die Größe des Bildfenster-Lichtkreises genau auf das Bildfenster abgestimmt ist.
Den Bildfenster-Lichtfleck könnte man verändern, indem man Spiegel verschiedener Brennweiten benützt. Das ist aber, zumindest für die großen Hochleistungslampen mit Spiegeln von 356mm, nicht möglich, weil diese Spiegel nur in einer einzigen Brennweite hergestellt werden.
Eine zweite Möglichkeit, die Größe des Bildfenster-Lichtkreises zu beeinflussen ist die, daß man den Abstand Spiegel - Bildfenster verändert. Wird dieser Abstand nämlich sehr groß, so bekommt man auch eine sehr starke Vergrößerung des Kraters am Bildfenster. Ist der Abstand Spiegel - Bildfenster dagegen klein, so wird die Abbildung des Kraters im Bildfenster eben entsprechend kleiner sein.
Man kann sich die Wirkung, die die Veränderung des Spiegelabstandes vom Bildfenster hat, so vorstellen, wie die Auswirkungen, die der Abstand eines Kinoprojektors von der Leinwand auf die Bildgröße hat. Dort ist es ja auch so, daß bei einer festen Objektiv-Brennweite das Bild auf der Leinwand um so größer wird, je größer die Projektionsentfernung ist und daß umgekehrt das in seinem Format gleichbleibende Kinobildchen eben entsprechend kleiner abgebildet wird, wenn die Projektionsentfernung geringere Werte annimmt.
Die neuen BAUER-Leuchtfeldinseln
Die Veränderung des Abstandes Spiegel - Bildfenster bringt bei einer serienmäßigen Kinospiegellampe aber erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Erstens wird die Konstruktion, die zur Verschiebung des Spiegels notwendig ist, die Lampe verteuern, zweitens kann man, wenn man den Spiegel näher als bisher an das Bildfenster heranrückt, nicht mehr Kohlenstifte mit 450 mm Länge verwenden.
Um dieser Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen, haben wir eine Lösung gesucht, um auf optischem Wege eine scheinbare Verlängerung oder Verkürzung des Abstandes Spiegel - Bildfenster zu erreichen. Das Ergebnis dieser Arbeiten sind die neuen BAUER-Leuchtfeldinseln, die jetzt für alle Kohlenarten und alle Strombelastungen lieferbar sind.
Die Wirkungsweise der BAUER-Leucht-feldlinsen.
Unsere HI 75- und HI 75 A- Spiegellampen sind so konstruiert, daß man bei dem handelsüblichen Bogenlampenspiegel mit 356mm Durchmeser und einer Brennweite von f = 113mm eine optimale Lichtausnuteung bekommt, wenn eine 8mm HI-Pluskohle gebrannt wird. Werden stärkere Kohlen verwendet, also 9, 10 oder 11mm- HI-Kohlen oder auch Reinkohlen, so wird bei der konstanten Vergrößerung des optischen Systems der Bildfenster-Lichtkreis zu groß werden. Das Bildfenster kann nur einen Teil des vom Spiegel abgegebenen Lichts auswerten.
Umgekehrt wird bei HI-Pluskohlenstärken unter 7,5mm der Bildfensterlichtkreis zu klein und die Ausleuchtung des Bildfensters nicht die nötige Gleichmäßigkeit haben.
In beiden Fällen kann man nun mit den BAUER-Leuchtfeldlinsen den Abstand des Spiegels vom Bildfenster optisch verkürzen oder verlängern, d. h. die Leuchtfeldlinse wirkt so als ob bei starken Kohlen der Spiegel näher am Bildfenster, bei dünneren Kohlen der Spiegel weiter vom Bildfenster abgerückt würde.
Man braucht aber keine kostspielige Versteileinrichtung für den Bogenlampenspiegel und hat außerdem die Möglichkeit, nach wie vor die vollen Kohlenlängen von 450 mm für die Pluskohle und 400 mm für die Minuskohle zu verwenden.
.
Wärmeschutz
Bei der Verwendung unserer BAUER-Leuchtfeldlinse wurde besonders daraufhin gearbeitet, daß dieses wichtige optische Element den bei hohen Stromstärken auftretenden starken Wärmebeanspruchungen gewachsen ist. Die normale Leuchtfeldlinse für Reinkohlenbetrieb bis 35 A und für HI-Betrieb über 65 A erfordert deshalb eine besondere Fassung, in der die Linse völlig wärmeisoliert eingebettet ist.
Zur Erzielung einer bestmöglichen Bildausleuchtung, unter der wir eine maximale Mittenhelligkeit und einen Randabfall von nicht mehr als 25% verstehen (unter der Voraussetzung natürlich, daß normale Objektive mit genügend großen Eintrittspupillen verwendet werden), werden für die verschiedenen Kohlenarten und Strombelastungen in den HI 75 und HI 75 A sowie in der HI 110 folgende Linsen benötigt:
Für Normalfilm und einfaches Breitbild
| Strom- | Kohlenart | Kohlen- | Leuchtfeldlinse |
| belastung | stärke + Kohle | ||
| 30-37 Amp. | RK | 13 mm | RF 76/101X |
| 25-32 A | RK | 12 mm | RF76/101X |
| 20-27 A | RK | 11 mm | RF 76/103X |
| 15-21 A | RK | 10 mm | RF 76/103X |
| 95-110 A | HI | 11 mm | RF 76/101X |
| 80-95 A | HI | 10 mm | RF 76/101X |
| 65-75 A | HI | 9 mm | RF 76/103X |
| 55-65 A | HI | 8 mm | - |
| 50-60 A | HI | 7,5 mm | - |
| 45-55 A | HI | 7 mm | RF77/101X |
| 40-50 A | HI | 6,5 mm | RF77/101X |
| 35-45 A | HI | 6 mm | RF 77/103X |
Für CinemaScope-Projektion
| Strom- | Kohlenart | Kohlen- | Leuchtfeldlinse |
| belastung | stärke + Kohle | ||
| 45-55 A | HI | 7 mm | RF 77/103X |
| 50-60 A | HI | 7,5 mm | RF77/101X |
| 55-65 A | HI | 8 mm | RF77/101X |
| 65-75 A | HI | 9 mm | - |
| 80-94 A | HI | 10 mm | RF 76/103X |
| 95-110 A | HI | 11 mm | RF 76/101X |
.
Entnommen der „Bauer-Filmpost"
.
Die Titel-Seite von Heft 5 / 1954
"Der erste Mitarbeiter des Filmtheaters"
„Die Sorge um konkurrenzfähige Filmvorführer hat den Wirtschaftsverband der Filmtheater, Baden-Württemberg, veranlagt, das Fachblatt 'DER FILMVORFÜHRER' herauszugeben. Die technische Entwicklung und die zu erwartende Konkurrenz durch das Fernsehen machen es unbedingt erforderlich, daß ein Filmvorführer, der als erster Mitarbeiter im Filmtheater wirkt und anzusprechen ist, über alle technischen Neuerungen und Erkenntnisse ausführlich und umfassend informiert wird. Ein neu auftretendes Projektionsverfahren darf für einen verantwortungsbewußten Filmvorführer kein Buch mit sieben Siegeln sein! Wir wollen Ihnen helfen Ihre technischen Kenntnisse zu erweitern und beabsichtigen mit dem Fachblatt 'DER FILMVORFÜHRER' alle Probleme dieses wichtigen Berufszweiges der Filmbranche anzuschneiden."
Horst Axtmann schreibt : Ab jetzt im "Verlag FILM-ECHO"
Mit diesen zielsetzenden Worten führte der 1. Vorsitzende des WdF Baden-Württemberg, Johannes Kalbfell, im Januar dieses Jahres die 1. Folge der neuen Fachzeitschrift DER FILMVORFÜHRER ein. Und mit derselben Verpflichtung hat der größte (??) deutsche Filmfachverlag FILM-ECHO das Fachorgan der Filmvorführer, das in umfassenden Informationen aus der Theaterpraxis und für die Praxis orientieren und weiterbilden wird, übernommen.
Alle Filmvorführer in sämtlichen deutschen Lichtspieltheatern sollen und müssen Gelegenheit nehmen, am Aufbau und der Gestaltung ihres eigenen Fachblattes Anteil zu nehmen; keiner ist unter den vielen Tausend Berufskollegen der Filmvorführer-Sparte, weder die „alten Hasen" und schon gar nicht der in Kurzlehrgängen geschulte Nachwuchs, der bereits alles um die Technik eines Filmtheaters, wie sie ist und vor allem, wie sie sich gerade in unseren Tagen stetig weiter entwickelt, in jedweden Einzelheiten beherrscht.
Das ist der Grund für die Verlagsübernahme des Fachblattes DER FILMVORFÜHRER durch den Verlag FILM-ECHO: Nicht nur die Filmtheater Baden-Württembergs sind auf beruflich fortgeschrittene und technisch prädestinierte Theatertechniker angewiesen, sämtliche Lichtspielhäuser des gesamten Bundesgebietes und weit darüber hinaus brauchen sie.
Der Fachverlag FILM-ECHO wird dafür sorgen, daß das rechte Blatt in die richtigen Hände kommt! Die Filmtheaterbesitzer aber - denn in ihrem Interesse liegt es auch - werden uns dabei helfen, daß in keinem Lichtspielhaus ein Filmvorführer tätig ist, der sich nicht durch das regelmäßige und intensive Studium des neuen Fachblattes DER FILMVORFÜHRER auf dem laufenden hält und sich, seinen ständigen Aufgaben entsprechend, unentwegt weiterbildet.
Da die ersten vier Ausgaben DER FILMVORFÜHRER vergriffen sind, ist uns eine Nachlieferung leider nicht möglich. Wir werden deshalb den bereits behandelten Stoff sukzessive wiederholen, empfehlen Ihnen aber, sehr geehrte Herren Theaterbesitzer und Filmvorführer, von diesem Heft ab umgehend ein laufendes Abonnement des Fachblattes DER FILMVORFÜHRER zu bestellen.
Bedienen Sie sich bitte der beigefügten Bestellkarte. Es wäre unklug, wenn Sie 50 oder 75 Pfennige sparen würden, anstatt unbedingt erforderliches Wissen und sich daraus ergebendes Können dafür einzuhandeln.
Und vergessen Sie außerdem nicht: wir bitten um Ihre Mitarbeit, sind Ihnen für Anregungen dankbar und freuen uns auf Ihr Echo.
Horst Axtmann - Verlagsleiter des FILM-ECHO
.
Die neuesten Bild- und Tonverfahren (Teil I)
.
A. Die neuen Bild-Verfahren
Man kann hierbei drei Hauptgruppen unterscheiden: die echten stereoskopischen Verfahren, die Panorama - Verfahren und sonstige neue Verfahren wie Garutso- Plastorama, VistaVision und Cinemascope.
.
I. Die stereoskopischen Filmverfahren
Unter „Stereoskopie" versteht man (im Jahr 1954) die räumliche Darstellung eines Objektes bzw. eines Vorganges in seinen 3-Dimensionen: Höhe, Breite, Tiefe.
Daher erhielten auch die Filmverfahren, die sich mit dieser Darstellung befassen, die Bezeichnung: „3D-Verfahren". Damit soll aber gleichzeitig festgelegt sein, daß diese Bezeichnung „3D" nur für die echte stereoskopische Darstellung angewandt werden kann, nicht aber für die sog. „Panorama-Verfahren", die zwar einen räumlichen Eindruck vermitteln, aber mit 3D und „Plastik" usw. nichts zu tun haben.
Bei der räumlich-bildlichen Darstellung eines Objektes wird das Prinzip des menschlichen Augensystems nachgeahmt. Die Doppeläugigkeit des menschlichen Organismus erzeugt im Gehirn die räumliche Vorstellung des Sehens. Daher müssen bei der bildlichen und filmischen Rekonstruktion dieses Vorganges zwei Bildaufnahmen hergestellt werden, die auf die Bildwand projiziert, sich mit besonderen optischen und technischen Hilfsmitteln zu einem räumlichen, d. h. stereoskopischen Eindruck verschmelzen.
Dieser Eindruck entsteht aber nur dann im menschlichen Gehirn, wenn dafür Sorge getroffen ist, daß jedes der beiden Augen nur das Teilbild zu sehen bekommt, das es auch beim natürlichen Sehen empfängt.
Bei der Herstellung eines stereoskopischen oder 3D-Films muß man also jeweils zwei Aufnahmen machen, die entweder als Teilbilder mit halber Normalfilmgröße auf einem Filmband vereinigt werden (Einfilm-Verfahren) oder im normalen 35mm-Filmformat auf zwei getrennte Filme aufgenommen werden (Zweifilm-Verfahren).
Abb. 1 zeigt links das Positiv eines Normalfilms nach dem Zweiband-Verfahren, rechts das Positiv eines Films nach dem Einfilm-Verfahren.
.
Das Einfilm-Verfahren
Das Einfilm-Verfahren, in Deutschland bisher nur von Zeiss-Ikon angewendet, verwendet zwei Teilbilder, die mit einer Stereo-Kamera aufgenommen werden, deren Objektive etwa im Augenabstand angebaut sind. Um die Bilder auf der Fläche des normalen Filmbildes von 16 x 22mm unterzubringen, werden sie um 90 Grad gedreht und nebeneinander gesetzt (s. Abb. 1 rechts) und bei der Wiedergabe durch die Stereo-Optik wieder um 90 Grad geschwenkt, so daß sie nunmehr aufrecht stehen.
Durch das Stereo-Objektiv werden die beiden Bilder auf der Bildwand zur Deckung gebracht. Da sie jedoch mit einem gewissen Objektiv-Abstand aufgenommen sind, sind die Bildkonturen für das unbewaffnete Auge unscharf und das Bild vermittelt auch zunächst noch keinen räumlichen Eindruck, da beide Augen beide Bilder gleichzeitig sehen.
Um die Trennung für beide Augen durchzuführen, bedient man sich eines optischen Hilfsmittels, der sog. „Polarisation", welche es ermöglicht, das aus dem Objektiv abgestrahlte Licht in zwei Sorten mit senkrecht oder schräg zueinander stehenden Schwingungsrichtungen aufzuteilen.
Das wird einmal bewirkt durch Polarisationsfilter, die vor dem Objektiv in den Strahlengang eingeschaltet oder in das Objektiv eingebaut werden und durch Polarisations-Brillen, die bei der Betrachtung des Bildes dem menschlichen Auge vorgesetzt werden.
Hierdurch wird bei der Projektion erreicht, daß das linke Auge nur das ihm zukommende Bild sieht und das rechte Auge jeweils das andere. Im Gehirn werden dann, wie beim natürlichen Sehen, beide Bilder zu einem räumlichen Bildeindruck vereinigt (Abb. 2).
Vorteile des Einfilm-Verfahrens
Für die Vorführung ist nur ein Projektor erforderlich; daher ist pausenlose Vorführung mit zwei Projektoren möglich, die Bilder erscheinen in echter Stereoplastik, der Stereovorsatz kann an den normalen Projektor angesetzt werden; ohne diesen Vorsatz ist der Projektor sofort zur Vorführung normaler Filme geeignet, die zwei Teilbilder lassen sich, da auf einem gemeinsamen Film vereinigt, leicht auf der Leinwand zur Deckung bringen.
Nachteile des Einfilm- Verfahrens
Große Lichtverluste bei der Projektion, daher doppelter bis dreifacher Licht- bzw. Strombedarf, wegen des kleineren, dem 16 mm-Schmalfilm ähnelnden, Bildformates praktisch doppelte Vergrößerung gegenüber Normalfilm, Objektive der halben Brennweite erforderlich, um gleichgroße Bilder wie bei Normalfilm zu erzielen.
(Kurz-brennweitige Objektive sind lichtschwächer als die normalen und haben geringere Randschärfe). Infolge dieser Nachteile wird das Einfilm-Verfahren - wenn überhaupt - nur für kleine und mittlere Theater in Frage kommen. Das von Zeiss Ikon entwickelte und bisher nur von Böhner-Film benutzte Verfahren wurde bis jetzt nur für Werbe- und Versuchsfilme angewendet. Wesentlich mehr Aussicht auf Erfolg hat das Zweifilm-Verfahren, das z. T. bei uns schon praktisch erprobt wurde.
Das Zweifilm-Verfahren
Das Zweifilm-Verfahren, ein von mehreren amerikanischen Firmen (Warner, Paramount usw.) und auch von Philips in Deutschland eingeführte System verwendet zwei getrennte Filmbänder für Aufnahme und Wiedergabe und dementsprechend auch zwei Wiedergabe-Projektoren.
Damit die beiden Bilder auf der Bildwand zur Deckung kommen, müssen die beiden Projektoren sehr sorgfältig nach Höhe und Seite ausgerichtet sein und vollkommen synchron bzw. bildphasengleich laufen. Das wird durch mechanische oder elektrische Kupplung der beiden Projektoren erreicht.
Für die mechanische Kupplung der beiden Projektoren werden Gelenkwellen benutzt, die die beiden Getriebe über Zahnrad und Kette verbinden und so konstruiert sind, daß sie bei Bedarf schnell gelöst werden können, falls zwischenzeitlich normale Filme vorgeführt werden sollen (Wochenschau, Kultur -und Reklamefilme) (Abb. 3).
.
Die heute häufiger angewendete elektrische Kupplung der beiden Projektoren wird durch sog. „Gleichhaltemotoren" (Interlockmotoren) bewirkt, die zusätzlich zum Antriebsmotor des Projektors angebaut werden oder mit dem Antriebsmotor organisch verbunden sind, wie es z. B. bei Philips der Fall ist.
Durch eine besondere Steuerung dieser Gleichhaltemotoren wird erreicht, daß beide Filme automatisch synchron laufen und auch beide Maschinen phasengleich anlaufen. Bedingung ist natürlich, daß beide Filme bildgleich eingelegt werden und daß bei einem Riß des einen Films aus dem zweiten die gleiche Anzahl Bilder herausgeschnitten wird.
Zur genauen Justierung der beiden Projektoren und zur ständigen Nachkontrolle dieser Einstellung bedient man sich zweckmäßig des von Klangfilm herausgebrachten „Stereo-Einstellfilms." Für die Projektion von Filmen nach dem Zweifilm-Verfahren sind keine besonderen Objektive erforderlich, d. h. es können die vorhandenen weiter benutzt werden, da die Filmbildgröße ja die gleiche geblieben ist, wie beim Normalfilm. Selbstverständlich sind auch hier, wie beim Einfilmverfahren, Polarisationsfilter und -Brillen für die Bildtrennung nötig.
Vorteile des Zweifilm-Verfahrens
Nur geringer Mehrbedarf an Licht gegenüber Normalfilm-Projektion (infolge der Pola-Filter), normale Objektive gleicher Brennweite wie bei Normalfilm-Projektion, echte Stereoplastik.
Nachteile des Zweifilm-Verfahrens
Doppelter Stromverbrauch gegenüber Normalfilm-Vorführung, da ständig beide Bogenlampen in Betrieb sind, größere Gleichrichter-Einheiten erforderlich, keine pausenlose Vorführung, da in den seltensten Fällen vier Projektoren aufgestellt werden können (Einschränkung der entstehenden Pausen durch Verwendung von 1.800m-Trommeln und -Spulen), Störung des plastischen Eindrucks durch falsches Filmeinlegen möglich (Behebung dieses Fehlers nur durch Stillsetzen der Maschinen und Umlegen des Films oder durch zusätzlich angebautes Differential - Getriebe zum Nachsynchronisieren möglich).
Maßgebend für die einwandfreie Wiedergabe von plastischen Filmen nach dem Ein- und Zweifilm-Verfahren ist die Bildwand. Diese muß ein gutes Reflexionsvermögen besitzen und metallisiert sein, um zu verhindern, daß das auffallende polarisierte Licht nicht depolarisiert wird und dadurch den plastischen Eindruck der Bildwiedergabe stört. Es dürfen auch nur solche Pola-Filter und -Brillen verwendet werden, die eine Gewähr für praktisch vollkommene Löschung der jeweiligen Teilbilder geben. Ist das nicht der Fall, dann erhalten die Objekte des Bildinhaltes doppelte Konturen und das Betrachten solcher Bilder ermüdet die Augen. Pola-Filter und -Brillen werden in einwandfreier Ausführung durch die Firma Käsemann, Oberaudorf/Inn geliefert (das war imjahr 1954 !).
geparkt
Bild 1 - Links: Positiv eines Normalfilms für Zweifilmverfahren; rechts: Positiv eines Stereofilms für das Einfilmverfahren
Bild 2 - Schematische Darstellung der Raumfilm-Projektion, System Zeiss Ikon
Abb. 3: Mechanische Gleichlaufeinrichtung an der Bauer B12 für Zweifilm-Verfahren
.
II. Die Panorama-Verfahren
Eine weit größere Bedeutung als die sog. „3D-Verfahren" haben die Panorama-Verfahren in den letzten Monaten (des Jahres 1953/54) in Deutschland erlangt. Diese Verfahren haben mit Plastik bzw. Stereoskopie oder 3D nichts zu tun.
Sie sind nur auf Illusion abgestellt, die durch eine panoramaartige Vergrößerung des Bildes erreicht wird. Diese Vergrößerung erzielt allerdings gegenüber der Normalfilm-Projektion einen räumlichen Eindruck, der durch den Raumton, von dem später noch zu berichten sein wird, noch unterstützt wird.
Der wesentlichste und auf den Zuschauer am stärksten wirkende Eindruck wird bei den Panorama-Verfahren dadurch erreicht, daß die seitliche Begrenzung der Bildwand so weit hinausgeschoben ist, daß sie praktisch vom Zuschauer gar nicht wahrgenommen wird. Er fühlt sich praktisch in die Filmhandlung hineinversetzt.
Gigantische Bildwände
Um diese Wirkung zu erreichen, verwendet man Bildwände, die in ihrem Seitenverhältnis von den bisher üblichen 3:4-Verhältnis (1:1,33) abweichen und Werte bis zu 1:3,25 erreichen.
Es ist leider heute noch so, daß fast jedes nachstehend beschriebene Verfahren ein anderes Seitenverhältnis benutzt und daß es bisher trotz starker Bemühungen der interessierten Stellen nicht gelungen ist, sich
auf ein Normal-Seitenverhältnis von etwa 1:1,8 bis 1:2 zu einigen. Welches Durcheinander noch besteht, zeigt die Abb. 4.
Von den bisher bekannt gewordenen Panorama-Verfahren haben folgende bis jetzt eine gewisse Bedeutung erlangt: CINERAMA und CINEMASCOPE, das nach älteren deutschen Patenten von der Centfox entwickelt wurde und heute auch von MGM, Warner, Paramount und Am. Universal benutzt wird.
Abb. 4: So sieht das derzeitige Durcheinander in den Seitenverhältnissen d. Breitwand-Projektion aus
.
a) CINERAMA
Hierbei wird eine gebogene Bildwand von etwa 8m x 22m bei einer Krümmungstiefe von 1,5m verwendet, auf die von 3 im Halbkreis in Boxen (im Zuschauerraum) aufgestellten Kino-Projektoren 3 Filme über Kreuz so projiziert werden, daß sie auf der Bildwand ein geschlossenes Bild ergeben.
Die hierbei entstehenden Bildränder zwischen dem mittleren und den beiden Außenbildern werden durch eine Wischvorrichtung unkenntlich gemacht. Zur Vermeidung von Reflexen an den Seitenteilen der Bildwand ist diese in etwa 1100 jalousieartig angeordnete Streifen aufgeteilt.
Der technische und personelle Aufwand für eine solche CINERAMA-Anlage ist sehr groß. Außer den 3 Projektoren wird noch ein vierter Projektor benutzt, auf dem der vierte, der Tonfilm mit 6 Tonspuren läuft.
Hinter der Bildwand befinden sich 5 Lautsprechergruppen und zusätzlich noch zwei Gruppen im Zuschauerraum für die Effekte. Außer der dazu gehörigen entsprechend großen Verstärker-Anlage ist noch eine Tonkontroll- und -Steuer-Einrichtung und eine Bildkontroll-Einrichtung für die „nahtlose" Einstellung des Bildes erforderlich. Personal einschließlich des Überwachungs- Ingenieurs für die Vorführung: 7 Mann!
(Fortsetzung folgt.)
Impressum DER FILMVORFÜHRER (neu - jetzt aus Wiesbaden)
Kinotechnische Informationen aus der Praxis - für die Praxis. - Monatlich erscheinende Fachzeitschrift im Verlag FILM-ECHO, Wiesbaden, Frankfurter Str. 28, Tel.: 2 68 42 und 2 75 98. - Verlagsleiter: H. A x t m a n n.
Redaktionelle Bearbeitung und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. P. Zschoche. - Bezugspreis: DM 0,75 monatl. (zuzügl. Versandkosten) ; für Dauerabonnenten des FILM-ECHO DM 0,50 monatl. (zuzügl. Versandkosten). - Druck: Druckerei Erwin Chmielorz, Wiesbaden, Herrnmühltgasse 11, Tel.: 9 03 41.
.