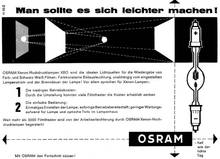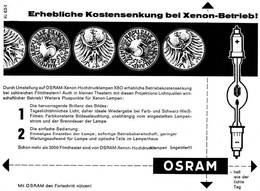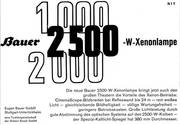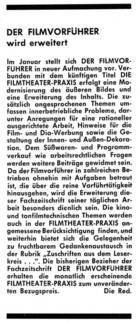Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 10 - 1963 - geparkt
.
Die Titel-Seite von Heft 10/1963 (Oktober 1963) - 10. Jahrgang
"Stereo-Schallplatten im Filmtheater"
Die beachtlichen Qualitätssteigerungen, welche die Mehrkanal-Verfahren bei der Tonfilm-Wiedergabe gebracht haben, führten zwangsläufig dazu, auch bei der Verwendung von Schallplatten als Tonträger eine stereo-phonische, d. h. eine räumlich wirkende, Wiedergabe zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden Stereo- Schallplatten auf den Markt gebracht, die - ohne näher auf technische Einzelheiten einzugehen - so beschaffen sind, daß die Rillen dem Abtastkopf des Schallplattengerätes unterschiedliche Bewegungen erteilen, die ihrerseits wiederum voneinander unabhängige Spannungen zur Folge haben.
Während die Rillenränder der monorauralen, d. h. einkanaligen, Schallplatten parallel verlaufen, ist der Verlauf bei der Stereo-Schallplatte verschieden, entsprechend der - in diesem Falle - zweikanaligen Tonaufzeichnung.
Die Abtastnadel führt aus diesem Grunde außer den durch die Aufzeichnung bedingten seitlichen Schwingungen noch weitere Schwingungen aus, die durch Dauermagnete bewirkt werden, die unter einem Winkel von 45° an der Nadel befestigt sind und dadurch eine zusammengesetzte »Wackelbewegung« des Abtastkopfes hervorrufen, wobei jeweils eine der beiden Rillenseiten bevorzugt wird und so ein räumlich wirkender Ton entsteht.
Voraussetzung für die stereophone Wiedergabe solcher Schallplatten ist ein zweikanaliger Vorverstärker für die Schallplatte. Die in vielen Filmtheatern vorhandenen Mehrkanal-Anlagen für Tonfilm (Vier-Kanal und Sechs-Kanal) können demnach für die Wiedergabe von stereophonischen Schallplatten nach entsprechender Umschaltung ohne weiteres verwendet werden. Andernfalls muß ein besonderer Zwei-Kanal-Vorverstärker beschafft werden, sofern sich dieser nicht schon im Stereo-Plattenspieler befindet. Die Wiedergabe erfolgt über zwei Lautsprechergruppen.
Jodlampen in der Film- und Kinotechnik Oktober 1963
In unserer „Rückschau auf die photokina" brachten wir in FV 4/63 auf Seite 5 im Abschnitt „Kinotechnisches Zubehör" einen Hinweis auf eine neuartige Lampentype, die als „Jodlampe" bezeichnet wird. Sie besitzt eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit, vor allem bei der Filmaufnahme, und wird voraussichtlich auch in der Projektionstechnik in Zukunft eine Rolle spielen, da sie gegenüber den bisher verwendeten „Glühlampen" eine Reihe besonderer Vorteile aufweist.
Die Verwendung von Projektions-Glühlampen für Scheinwerfer und sonstige Beleuchtungsgeräte, bei denen eine hohe Lichtleistung verlangt wird, wurde bekanntlich erst möglich, nachdem es gelungen war, den in den Lampen verwendeten Wolframdraht zu „wendein" und auf diese Weise kleine Leuchtkörper zu erhalten.
Nach diesem Prinzip konnten Projektions- bzw. Scheinwerferglühlampen für Belastungen bis zu 10.000 W und entsprechender Lichtleistung entwickelt werden, die sich insbesondere als Studiobeleuchtung und für Großflächenausleuchtung gut bewährt haben, da sie in der Handhabung und Bedienung wesentliche Vorteile gegenüber den Bogenlampen- Scheinwerfern aufweisen.
Von Osram und von Philips
Einen neuen Impuls für die Bühnen- und Studiobeleuchtung bringt nunmehr die eingangs erwähnte „Jodlampe", wie sie von Osram und von Philips hergestellt wird.
Bei den normalen Wolframlampen nimmt infolge des Verdampfungsprozesses, dem das Wolframwendel im Betrieb unterliegt, im Laufe der Lebensdauer der Lampe die Lichtleistung wie auch die Farbtemperatur erheblich ab, wobei auch die Nennstromaufnahme zurückgeht, und gleichzeitig eine allmähliche Schwärzung des Lampenkolbens eintritt.
Um diese störenden Schwärzungen zu verringern, ging man dazu über, die Kolben mit Edelgas oder Stickstoff zu füllen. Durch diese Maßnahme wird im Betriebszustand der Lampe das „Füllgas" aufgeheizt, dehnt sich aus und übt einen gewissen Druck aus, der die „Emission" des Wolframdrahtes, d. h. die allmähliche Verdampfung, zwar hemmen, jedoch nicht völlig verhindern kann.
Durch die Verwendung von Joddämpfen in den Lampenkolben ist es nunmehr gelungen, den „regenerativen" Jodkreislauf in Gang zu setzen, d. h. das verdampfte Wolfram auf elektrochemischem Wege zurückzugewinnen.
Merkmale und Eigenschaften der Jodlampen
Ein besonderes äußeres Merkmal der Jodlampen sind die sehr kleinen Abmessungen; die weiteren Vorteile sind konstanter Lichtstrom, konstante Farbtemperatur und hohe Lichtausbeute.
Das Prinzip der Jodlampe beruht darauf, daß das vom Wendel durch Verdampfung emitierte Wolfram sich mit dem Jod zu durchsichtigem Wolfram-Jodidgas verbindet, sich also nicht an der Kolbenwand niederschlagen kann.
Voraussetzung für diesen Vorgang ist allerdings eine Temperatur an der Kolbenwand von etwa 600°C, wobei sich das Wolframjodid in der Nähe der heißen Wendel wieder in Wolfram und Jod aufspaltet. Das freigewordene Wolfram schlägt sich an der Wendel nieder; das Jod wird ebenfalls wieder frei. Dieser Regenerierungs- bzw. Rückgewinnungsprozeß wird unterstützt durch die hohe Temperatur des Wolframglühdrahtes, die etwa 1500°C beträgt.
Dieser regenerative Jodkreislauf geht ständig weiter und bewirkt, daß im Laufe der Lebensdauer der Jodlampe nur eine ganz unbedeutende Verringerung des Lichstromes (etwa 10%) eintritt, wie auch eine nur geringe Veränderung der Farbtemperatur.
Die Folge dieser Maßnahme ist daher eine höhere Lebensdauer der Jodlampe, bzw. bei gleicher Lebensdauer wie sie normale Wolframlampen haben, eine höhere Lichtausbeute. Wesentlich ist jedoch, daß die Schwärzung des Kolbens völlig und die Verringerung der Wendelstärke fast verhindert wird.
Damit die Kolbenwand die vorerwähnte erforderliche Regenerierungstemperatur von 600°C annimmt, darf natürlich der Abstand zwischen dem Wolframglühdraht und dem Kolben der Lampe nur gering sein.
Quarzglas wegen der hohen Temperaturen
Aus diesem Grund und wegen der hohen Temperaturen wird daher für den Kolben ein hitzebeständiges Material, z. B. Quarzglas, verwendet. Dadurch konnten andererseits die Jodlampen sehr kleine Bauformen erhalten, so daß es möglich wurde, auch die für den Studiobetrieb, sowie die für Bühnenbeleuchtung und Anstrahier mit Jodlampen bestückten Beleuchtungsgeräte wesentlich kleiner und leichter zu bauen als bisher, wodurch sie auch neue Möglichkeiten für die Aufnahmebeleuchtung bei Film und Fernsehen erschließen.
Bilder:
Größenvergleich der von Philips hergestellten Jodlampen mit Hilfe des oben abgebildeten Maßstabes. Die Abbildungen zeigen von oben nach unten die Jodlampe PF 800 R, die 1000 Watt-Jodlampe, Typ 13 989 R, die 2000 Watt-Jodlampe, Typ 13 026 R und die 10 000 Watt-Jodlampe Typ 13 017 K. (Foto: Philips)
Zeichnerische Darstellung der Quarz-Jodglühlampe für Foto-Aufnahmezwecke von Osram mit Meßangaben in mm. (Zeichnung: OSRAM)
Ausführung und Anwendung
Die Kolben der Jodlampen sind - wie die vergleichende Abbildung zeigt - langgestreckt und stiftförmig ausgeführt und werden in verschiedenen Leistungs- bzw. Belastungsgrößen geliefert.
So stellt z. B. OSRAM, die zunächst eine 650-Watt-Jodglühlampe auf den Markt gebracht hatten, zwei weitere Typen von Quarz-Jodglühlampen her; eine 800-Watt-Lampe für Foto-Aufnahmezwecke und eine Quarz-Jodglühlampe 1000 Watt für Flutlicht, die nach dem gleichen Prinzip wie vorstehend beschrieben arbeiten.
Im besonderen hat sich auch Philips der Entwicklung dieser neuartigen Lampentype gewidmet und vier verschiedene Typen herausgebracht. Dieses Jodlampenprogramm von Philips besteht aus der 1000-W-Jodlampe PF 800 R, einer weiteren Jodlampe, Typ 13 989 R, einer 2000-W-Jodlampe, Typ 13 026 R und der 10.000-W-Jodlampe, Typ 13 017 K.
Die 1000-W-Jodlampe PF 800 R ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und wird speziell in kleinen Aufnahmeleuchten für den Schmalfilmamateurbetrieb benutzt. Die 1000-W-Jodlampe, Typ 13 989 R, besitzt - wie die bisherigen Standardtypen des Berufsfilmers - eine konstante Farbtemperatur von 3200° Kelvin. Während die konventionellen „Fotolampen" eine Lebensdauer von etwa sechs Stunden haben, beträgt die mittlere Lebensdauer dieser 1000-W-Jodlampen etwa 15 Stunden und mehr.
Sie entspricht damit der Lebensdauer der üblichen Lampen für Farbaufnahmen in Filmateliers und Fotostudios. Aus diesem Grund ist sie auch in den Abmessungen größer als die PF 800 R. Eine sehr hohe Lichtleistung bei sonst gleichen Eigenschaften wie die 1000-WT-Jodlampe 13 989 R besitzt die neue 2000-W-Jodlampe, Typ 13 026 R.
Diese beiden Lampentypen wurden - zusammen mit der 10.000-W-Jodlampe - erstmals der Öffentlichkeit auf der photokina 1963 vorgestellt. Die 10.000-W-Jodlampe, Typ 13 017 K, kann als „Gigant" unter den Jodlampen von Philips bezeichnet werden. Sie hat eine Länge von 70,5cm und einen maximalen Durchmesser von nur 2,7 Zentimeter und ist für die Ausleuchtung von großen Flächen bestimmt. Wie von Philips berichtet wurde, konnte probeweise ein großes Stadion mit 24 dieser 10.000-W-Jodlampen so ausgeleuchtet werden, daß einwandfreie Film- und Fernsehaufnahmen gemacht werden konnten.
Kleine Bauformen mit hoher Lichtleistung
Die kleinen Abmessungen der Jodlampen ermöglichen den Einbau in Reflektoren, die das Licht sehr stark konzentrieren. Infolge dieser stärkeren Lichtkonzentration kann bei der Aufnahme auf einem Objekt eine etwa 3- bis 4-mal so hohe Beleuchtungsstärke erreicht werden, wie sie mit einer handelsüblichen Fotolampe von 500 Watt erzielt werden könnte.
Sowohl für die 16mm-Schmalfilmaufnahmen wie auch für Fotoaufnahmen steht mit diesen Jodlampen-Reflektoren eine sehr handliche und leicht transportable Beleuchtungseinrichtung zur Verfügung. Diese Reflektoren eignen sich auch sehr gut für die Anstrahlung des Vorhanges oder der Außenfront des Theaters.
Allerdings muß bei der Verwendung der Reflektoren darauf geachtet werden, daß die eingebaute Jodlampe im wesentlichen in waagerechter Stellung brennt, da nur so der oben geschilderte Regenerierungsprozeß einwandfrei funktioniert.
Die Lichtfarbe der Jodlampe ist für Aufnahmen auf die gängigen Kunstlichtfarbfilme abgestimmt. Sie kann jedoch durch sogenannte „Skylight-Filter" verbessert bzw. geändert werden. Wie eingangs erwähnt, kann angenommen werden, daß die weitere Entwicklung der Jodlampe dazu führen wird, daß sie in Zukunft nicht nur für die Aufnahmetechnik interessante Anwendungsmöglichkeiten bietet, sondern auch in der Film- und Diaprojektion benutzt werden kann, ohne natürlich die Gasentladungslampen (Xenon- und Impulslampen) zu verdrängen, die heute in der Projektionstechnik eine steigende Bedeutung gewonnen haben. -Z-
Prinzip und Aufbau von Lautsprechern (Teil ??) Oktober 1963
In FV 2/62 brachten wir unter dein Titel: „Wissenswertes über Kino-Lautsprecher" eine Übersicht über die historische Entwicklung, die Technik und Konstruktion und die Anpassung der Lautsprechersysteme sowie über das Prinzip der Schallabstrahlung.
Es folgten Angaben über Lautsprecher Systeme moderner Bauart und über die Anordnung und Wartung der Lautsprecher. In FV 7/62 wurde diese Berichterstattung, die vor allem dem Vorführer-Nachwuchs Informationen über das Lautsprecher gebiet geben sollte, unter dem gleichen Titel fortgesetzt, wobei die allgemeinen Merkmale der Lautsprecher und technische Einzelheiten behandelt wurden, insbesondere die Phasenlage und Anordnung, die Schallabstrahlung und der Begriff „elektrische Weiche".
Um auch den in letzter Zeit hinzugekommenen Beziehern des FV einige grundlegende Begriffe auf dem Lautsprechergebiet zu erläutern, bringen wir nachstehend nochmals eine kurze Abhandlung über „Prinzip und Aufbau von Lautsprechern", die wir nach einem Beitrag des Herrn W. Ankenbrand, Bremen, redaktionell bearbeitet und ergänzt haben.
Die Aufgabe eines Lautsprechers
Die Aufgabe eines Lautsprechers ist es, elektrische Schwingungen in akustische umzuwandeln. Diese Aufgabe wird auf unterschiedliche Art und Weise, je nach Konstruktionsform und System des verwendeten Lautsprechers, gelöst. Man unterscheidet eine Reihe verschiedener Lautsprechersysteme; jedoch sollen der besseren Übersicht wegen nachstehend nur jene Lautsprecher-Typen behandelt werden, die im Filmtheaterbetrieb (im Zuschauerraum und im Vorführraum) verwendet werden. Hierzu gehört zunächst der „elektromagnetische" Lautsprecher, der an sich das einfachste Lautsprecher-System ist.
.
Elektromagnetisches System
In seinem Aufbau besteht der elektromagnetische Lautsprecher im wesentlichen aus einem Hufeisenmagneten und einer davor angeordneten dünnen Membran. An den Polschuhen des Permanentmagneten befinden sich Wicklungsspulen, die vom Sprechwechselstrom durchflossen sind, der von der Endröhre des Verstärkers kommt.
Das hierdurch entstehende Wechselfeld überlagert sich dem konstanten Feld des Dauermagneten und versetzt den „Anker" der Membran, der im Ruhezustand zwischen den Polschuhen im Gleichgewicht liegt, in Vibrationsbewegungen, die den Schwingungen des Sprechwechselstroms entsprechen. Der elektromagnetische Lautsprecher besitzt ein schmales Frequenzband und neigt daher zu Verzerrungen. Er ist daher im Filmtheater nur begrenzt verwendbar, z. B. als Kontroll-Lautsprecher.
Eine qualitativ bessere Tonwiedergabe gewährleisten die „elektrodynamischen" Lautsprecher. Bei diesem System wird nicht die wechselnde Feldstärke eines Magneten zur Bewegung der Membran ausgenutzt, sondern ein sog. „Topfmagnet" mit konstanter Feldstärke verwendet.
Vor diesem Topfmagneten ist eine Konusmembran angeordnet, die sich in zylindrischer Form fortsetzt und mit einer „Tauchspule" bewickelt ist. Diese von der Sprechwechselspannung durchflossene Tauchspule, auch „Schwingspule" genannt, ist in den Luftspalt des Topfmagneten eingehängt. Das Vibrieren der Membran entsteht in diesem Fall durch den sich verändernden Kraftunterschied zwischen dem Magnetfeld des Topfmagneten und dem Induktionsfeld der Tauchspule.
Der elektrodynamische Lautsprecher
Bei diesem dynamischen Lautsprechersystem unterscheidet man zwei Grundtypen: Bei der älteren Form des fremderregten Lautsprechers ist der Topfmagnet kein Dauermagnet, sondern ein Elektromagnet, dessen Wicklung durch einen Gleichstrom aus einem besonderen „Feldgleichrichter" gespeist wird. Man war früher, insbesondere bei Lautsprechern mit großer Leistung, zur Verwendung von Elektromagneten gezwungen, da es damals keine Dauermagnete mit der notwendigen Feldstärke gab. Später ist es jedoch gelungen, Dauermagnete mit der erforderlichen Feldstärke zu entwickeln, so daß auch größere Lautsprecher mit Dauermagneten ausgerüstet werden konnten.
Diese Lautsprecher mit Dauermagnet werden „permanentdyniamische" Lautsprecher genannt. Sie bieten einmal den Vorteil, auf eine besondere Erregerspannung verzichten zu können, zum anderen weisen sie nicht den störenden „Eigenbrumm" fremderregter Lautsprecher auf. W. Ankenbrand
Schematische Darstellung eines elektrodynamischen Lautsprechers mit Topfmagnet, Erregerwicklung, Tauchspule und Konusmembran, sowie den Anschlüssen für die Sprechwechselspannung und die Felderregung.
(Zeichnung: W. Ankenbrand)
Seitenverhältnis 1,66:1
Im letzten Absatz unseres Berichtes: „Film- und Kinotechnische Normungsarbeit" auf Seite 5 dieser Ausgabe bringen wir einen Hinweis auf den Stand der Normungsarbeit für den Entwurf DIN 15'545 (Film 35 mm, Bildgröße der Aufnahme und Wiedergabe (Kamera- und Projektorfenster), Seitenverhältnis 1,66:1), ein Verfahren, das als „Breitwandverfahren durch Bildabdeckung" bekannt ist und bisher das Bildwand-Seitenverhältnis 1,85:1 benutzte.
Obwohl es sich noch nicht um eine endgültige Norm handelt, da die Einspruchsfrist erst am 31.1.1964 abläuft, soll doch schon jetzt zur Information kurz darauf hingewiesen werden, daß der Vorschlag zur Änderung des Seitenverhältnisses auf 1,66:1 von der Technischen Kommission der SPIO stammt. Der Anlaß für diesen Vorschlag war die Erkenntnis, daß der Verlust an bildwichtigen Teilen bedeutend verringert und ein übermäßig breiter Bildstrich verhindtert wird, wie er sich ergibt, wenn die Aufnahme im Format 1,85:1 erfolgt. Außerdem wird der Bildeindruck bei diesem neuen Seitenverhältnis für den Beschauer besser.
In projektionstechnischer Beziehung ergibt sich bei dieser Umstellung auf das neue Bildwand-Seitenverhältnis allerdings die Notwendigkeit, ein Objektiv mit etwas längerer Brennweite zu verwenden, wenn man die vorherigen Projektionsabmessungen auf der Bildwand annähernd beibehalten will. Es gibt aber andererseits die weitere Möglichkeit, die bisherige Objektivbrennweite beizubehalten, wodurch sich ein projiziertes Bild mit etwas größerer Höhe als bei 1,85:1 ergibt.
Sofern die gesamte im Theater vorhandene Bildwandfläche genügend groß gewählt wurde, und die obere und untere Bildbegrenzung entsprechend versetzt werden kann, läßt sich demnach das vorhandene Objektiv ohne weiteres weiterverwenden. -Z-
DKG- und FAKI-Tagung in München Oktober 1963
In der Zeit vom 18. bis 21. September 1963 fanden in München zwei bedeutsame Tagungen statt, die ihre Höhepunkte in einem Empfang der DKG im Regina-Palast-Hotel München, mit anschließender Vortragssitzung in der TH München am 19. September und in der Vollsitzung des FAKI am 20. September in Geiselgasteig hatten.
Öffentlichkeitsarbeit in der Filmtechnik
Der Empfang der „Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V." (DKG) und des „Fachnormenausschuß Kinotechnik für Film-und Fernsehen e. V." (FAKI) im Regina-Palast-Hotel in München vereinigte neben Vertretern der Stadt München und des Landes Bayern eine große Anzahl namhafter Fachleute der Film-, Kino- und Fernsehtechnik aus der Bundesrepublik und West-Berlin sowie Angehörige der Filmwirtschaft, der SPIO und Vertreter der Tagespresse.
Zweck dieser Veranstaltung war die Absicht, die Leistungen der Film-, Kino- und Fernsehtechnik der Öffentlichkeit mehr als bisher nahe zu bringen und ihre Bedeutung im Rahmen der Filmwirtschaft zu unterstreichen.
In seiner Festansprache betonte der Vorsitzende des FAKI, Direktor Leo Mayer, daß die Filmtechnik am sogenannten Elend des deutschen Films nicht schuldig sei; sie hätte es lediglich versäumt, der Öffentlichkeit gegenüber in gebührender Weise hervorzutreten und Filmpolitik zu machen.
Anmerkung : Aha, also Schuld sind die anderen - wie immer. Das stimmt aber auch nur teilweise. Die "Schuldigen" wohnen ganz woanders, nämlich um aufkommenden Wohlstand und der aufkommenden Mobilität. Diese Artikel lesen Sie auf den Seiten des "Niedergangs der Film- und Kino-Branche".
Das sollte nunmehr - und damit wandte sich der Redner in erster Linie an die Tages- und Fachpresse - nachgeholt werden, insbesondere in den Wirtschaftsteilen der Tagespresse. In seinen weiteren Ausführungen wies Leo Mayer darauf hin, daß die geschichtliche Ausgangsbasis des Films die Filmtechnik gewesen ist, während sich die Filmkunst erst viel später auf den Grundfesten und Voraussetzungen entwickelt hat, welche die Technik geschaffen hatte.
Diese Statistiken (sind nicht von mir)
An Hand von interessantem Zahlenmaterial erbrachte der Redner den Beweis (Anmekrung : Eine ziemlich "dumme" Formulierung) für die Bedeutung und das Potential der Film- und Fernsehtechnik und führte dazu aus, daß die photochemische Industrie allein etwa 120.000 Menschen bei einem Ausstoß von etwa drei Milliarden Meter Film aller Sorten und Formate pro Jahr beschäftigt und daß pro Jahr für Film und Fernsehen bei uns z. Z. etwa 110 Millionen Meter Kinefilm verbraucht werden.
In den Studios und Filmkopieranstalten wurden im letzten Jahr für den Bedarf von Film und Fernsehen schätzungsweise 15,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet.
Die Filmtheater in der Bundesrepublik und West-Berlin zeigten nach den Angaben von Direktor Mayer im Kalenderjahr 1962 etwa 470 Spielfilme, von denen allerdings nur 63 aus der deutschen Produktion stammten.
Das I. und II. Fernsehen in Deutschland hat heute pro Jahr ein Programm von mehr als 4.000 Stunden Vorführzeit bereitzustellen, auf die etwa 80% Filmsendungen von Aktualitäten und Sendespiele entfallen. Das bedeute für den Bereich der Filmtechnik und Filmwirtschaft eine beträchtliche Steigerung des Volumens.
.
Und ganz wichtig sind unsere "Normen"
Hand in Hand arbeiten hier Forschung, Wissenschaft und Technik der Zubringerindustrie einerseits und der Atelierbetriebe andererseits mit einem enormen Aufwand an Mitteln und Investierungen aller Art.
Zur Lösung dieser Aufgaben und zum Austausch von Erfahrungen auf neutralem Boden wurde bereits im Jahre 1920 die „Deutsche Kinotechnische Gesellschaft" gegründet. Um andererseits die Einheitlichkeit der Geräte und Produkte und ihre Austauschbarkeit zu sichern, wurde im gleichen Jahr der „Fachnormenausschuß Kinotechnik" ins Leben gerufen, dem annähernd 600 Wissenschaftler und Techniker in seinen 18 Arbeitsausschüssen angehören.
In seinen Schlußworten wies der Redner darauf hin, daß oft die Frage von Seiten Außenstehender gestellt wird, ob die deutsche Film- und Kinotechnik mit der Technik des Auslandes, insbesondere mit der Amerikas, konkurrenzfähig ist. Diese Frage beantwortete Leo Mayer mit einem nachdrücklichen „Ja" und wiederholte seine Forderung - wie auch der nachfolgende Redner Prof. Dr. Theile vom Institut für Rundfunktechnik, München - nach mehr Öffentlichkeitsarbeit für Publikum und Staat, um Anteilnahme und Anerkennung zu erwecken und warnte gleichzeitig vor den Gefahren einer Vernachlässigung von Wissenschaft und Technik.
.
Tricktechnik bei Film und Fernsehen Oktober 1963
Die eingangs erwähnte Vortragssitzung der DKG in der Technischen Hochschule in München am 19. September 1963 wurde von Prof. Dr. Theile eingeleitet, der in seinen Ausführungen auf die Bedeutung und das Wesen der Tricktechnik bei Film und Fernsehen hinwies und zugleich feststellte, daß es in der Film- und Kinotechnik keinen Kampf Film gegen Fernsehen gäbe oder gegeben habe, vielmehr eine enge Zusammenarbeit.
- Anmerkung : Das ist schlicht gelogen. Es stimmt nicht, denn es gab natürlich einen Kampf, den aber das Kino verloren hatte. In USA durften Schauspieler nicht fürs Fernsehen arbeiten, sie wurden geächtet. Und in den USA gehen die Uhren immer 5 oder mehr Jahre vor - im Vergleich zu uns hier - bis eine dortige "Erscheinung" bei uns aufkommt.
.
Trickaufnahmen mit filmtechnischen Mitteln
Der erste Vortrag behandelte das Thema: „Gestaltung und Wirkung von Trickaufnahmen mit filmtechnischen Mitteln" und wurde vom Leiter des Trickfilmstudios der Bavaria, Herrn Theo Nischwitz, CDK, München, gehalten. Der versierte Vortragende wies eingangs darauf hin, daß schon in den Anfangszeiten der Filmherstellung mit Tricks gearbeitet worden ist, da schon die Anwendung von Blenden bzw. Einblendungen als Trick bezeichnet werden kann, so z. B. das Verschwinden und Auftauchen von Personen.
Weitere Tricks sind Bildfrequenzänderungen (Zeitraffer und Zeitdehner), Umkehrung des Filmablaufs (sichtbarer Rücklauf) und sog. „Kaschtrick's" mit feststehender Maske im Kompendium. Neben diesen einfachen optisch-mechanischen Filmtricks, die jedoch auch eine hohe Präzision erfordern, gibt es noch die komplizierten Tricks, die Kombinationstricks und besondere Tricks, z. B. Doppelgänger-Aufnahmen, Pyrotechnische Tricks, Puppentrick, Zeichentrick und Modelltrick.
Zu den Kombinationstricks gehört u. a. das bekannte Rückprojektionsverfahren, das Spiegeltrick-Verfahren von Schüfftan und das Wandermasken-Verfahren (Travelling-Matte).
Die Ausführungen des Vortragenden wurden wirkungsvoll unterstützt durch einen von der Bavaria zusammengestellten Film, der die Anwendung dieser Verfahren zeigte und durch Ausschnitte aus dem Film: „Das Spukschloß im Spessart", dessen Trickaufnahmen unter der Leitung von Theo Nischwitz hergestellt wurden und die Vielseitigkeit der Anwendung von optisch-mechanischen Tricks anschaulich zur Geltung brachten.
Bild
Ing. W. Dettmer, Technische Kommission der SPIO (r.) im fachlichen Gespräch mit unserem Technischen Redakteur, Dipl.-Ing. P. Zschoche auf dem Empfang der DKG und des FAKI in München. (Foto: DKG)
Und noch ein Vortrag Oktober 1963
In dem zweiten Vortrag des Abends sprach Dipl.-Ing. Gerd Högel, Institut für Rundfunktechnik, München, über: „Erzeugung spezieller Trickeffekte mit fernsehtechnischen Mitteln". Im Gegensatz zu den optisch-mechanischen Tricks wird hier mit elektronischen Tricks gearbeitet. Diese bestehen im wesentlichen in elektronischer Ausblendung, künstlichen vertikalen Verzerrungen und der Anwendung der horizontalen und vertikalen Raster-Modulation. Die hierbei benutzten Mittel sind - wie die interessanten Experimente zeigten - sehr vielseitig und kompliziert, so daß hier nicht näher darauf eingegangen werden kann.
Ein besonders wirkungsvoller Trick mit fernsehtechnischen Mitteln ist das elektronische Umrißverfahren, das - ebenso wie die verschiedenen Verzerrungsverfahren - im Experiment erläutert wurde.
Feinsicherungen - nah besehen Oktober 1963
Die Aufgabe der Feinsicherungen ist es, ein Gerät vor Überlastung und dadurch verursachter Zerstörung zu bewahren. Da die Daten des durch die Feinsicherung ?u schützenden Gerätes bekannt und jegliche betriebsbedingte Schwankungen der Leistungsaufnahme voraussehbar sind, ist es möglich, die Werte der Feinsicherung dem Gerät genau anzupassen. Aus diesem Grund werden verschiedene Anforderungen an die Feinsicherung gestellt.
Sie muß den normalen Betriebsstrom, sowie die z. B. durch Schwankungen der Netzspannung betriebsbedingten Abweichungen und die bei vielen Geräten sehr hohen Einschaltströme aushalten. Demgegenüber soll sie aber bei den oftmals nur geringfügig erhöhten, aber andauernden Überströmen, die infolge eines Fehlers im Gerät auftreten, abschalten. Weiterhin müssen die meist sehr hohen Kurzschlußströme sicher unterbrochen werden, d. h. das Glasröhrchen darf nicht zerspringen und die Kontaktkappen nicht verschmoren, um mechanische oder feuer- und hitzebedingte Schäden am Gerät zu vermeiden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wäre es ungenügend, die Feinsicherungen lediglich nach dem maximal ausgehaltenen Strom einzuteilen.
Man unterscheidet deshalb, ihrer Abschaltzeit entsprechend, drei unterschiedliche Gruppen:
3 Gruppen
.
- Träge Feinsicherungen
Sie sind bei sehr hohen, aber kurzzeitigen Stromstößen, die bei dem abzusichernden Gerät im Bereich des Normalen liegen, erforderlich. Es ist aber zu beachten, daß sie nur ein relativ geringes Schaltvermögen besitzen. - Mittelträge Feinsicherungen
Sie werden am meisten verwendet und sind wesentlich empfindlicher als die trägen Feinsicherungen, halten aber den erhöhten Einschaltströmen stand, wie sie bei Geräten auftreten, in denen sich kapazitive oder induktive Bauteile befinden. - Flinke Feinsicherungen
Sie sind nur zu empfehlen, wenn keine wesentlichen Einschaltströme auftreten und schon bei geringen und auch kurzfristigen Überströmen eine sichere Abschaltung erforderlich ist, z. B. bei empfindlichen Meßinstrumenten.
.
Bild:
Schematische Darstellung der im unten stehenden Artikel beschriebenen drei Arten von Feinsicherungen. (Zeichnung: W. Ankenbrand)
.
Die Zahlen
Auf den Kontaktkappen der Feinsicherung sind einige Buchstaben und Zahlen eingeprägt, deren Bedeutung im Folgenden erläutert werden soll.
Die erste der beiden eingeprägten, meist durch einen Schrägstrich getrennten Zahlen gibt Auskunft über die Stromstärke, die zweite über die Nennspannung. Also z. B. 1,6/250 bedeutet: Stromstärke 1,6 Ampere und Nennspannung 250 Volt. Der Buchstabe (B, C, D, E, oder G) nach dieser Zahlenangabe kennzeichnt das Schaltvermögen der Sicherung gemäß der hierfür geltenden VDE-Bestimmungen.
Befindet sich vor der Zahlenangabe ebenfalls ein Buchstabe, so bedeutet F = flink und T = träge. Mittelträge Feinsicherungen sind hier nicht besonders gekennzeichnet.
Abgesehen von diesen auf der Kontaktkappe eingeprägten Angaben und der Farbe der Verpackung (rot = flink, blau = mittelträge, grün = träge) gibt es einen weiteren Anhaltspunkt über die Abschaltzeit der Feinsicherung, allerdings nur dann, wenn das Glasröhrchen nicht mit einem lichtbogenlöschenden Mittel gefüllt ist. Und zwar unterscheiden sich die trägen, mittelträgen und flinken Feinsicherungen in ihrem Aufbau.
Die einfachste Form stellt die flinke Feinsicherung dar. Sie besitzt einen durchgehend glatten Schmelzleiter, der an den Enden mit den Kontaktkappen verlötet ist.
Die mittelträge Sicherung besteht aus einer mit der einen Kontaktkappe verlöteten Zugwendel, die wiederum durch eine Lötstelle mit dem aus zwei miteinander verlöteten Teilen bestehenden Schmelzleiter verbunden ist.
Die träge Ausführung erkennt man an den zwei in der Mitte verlöteten Zugwendeln.
Wie schon eingangs erwähnt, sollen die Feinsicherungen die meist sehr teuren Geräte vor der Zerstörung schützen. Baut man in ein Gerät eine falsche, z. B. anstelle einer flinken eine träge Sicherung ein, so kann das im Falle eines auftretenden Fehlers zur totalen Zerstörung des Gerätes führen. Gleichermaßen würde es zu unliebsamen Störungen führen, wenn man beispielsweise den Kohlennachschub-Motor im Lampenhaus mit einer flinken anstelle einer trägen Feinsicherung absichern würde. Es ist also unbedingt notwendig, bei der Auswahl einer Feinsicherung nicht nur auf die richtige Stromstärke zu achten, sondern auch auf die passende Abschaltzeit. - W. Ankenbrand
Aus der Praxis - für die Praxis - Oktober 1963
"Die Pflege von Bildwänden - Korrektur"
Unter diesem Titel brachten wir in FV 3/63, Seite 4, die Veröffentlichung einer Zuschrift von Herrn Ing. K. Borkenhagen, die sich mit der sachgemäßen Pflege von Bildwänden im Filmtheater beschäftigte. Zu dem gleichen Thema äußerte sich Herr Paul Weigel, Sistig, Krs. Schieiden, als Inhaber einer Spezialfirma für Bildwandaufarbeitungen und stellte uns aus seinem Tätigkeitsgebiet einen Beitrag zur Verfügung, dem wir die nachstehenden Ausführungen entnommen haben.
„Ausnahmen bestätigen die Regel"
..... sagt man meistens, wenn die Theorie vom grünen Tisch in eine Sackgasse geraten ist. Um die allgemein irrigen Auffassungen in der Behandlung von modernen Bildwänden klarzustellen, sei darauf hingewiesen,
daß mit Erfolg keine Bildwand gereinigt oder abgewaschen werden kann.
Erfahrungsgemäß vergilben weiße Plastik- oder Gewebewände im Laufe der Jahre so stark, daß ein einwandfreies und helles Bild nicht mehr erzielt werden kann und die erstrebte Bildbrillanz, vor allem bei einem hellen Himmel oder bei leuchtenden Farben, erheblich getrübt wird.
Da der Lichtverlust einer neuen Bildwand, bedingt durch die Ton-Perforation, schon etwa 10% beträgt, erhöht sich dieser Prozentsatz naturgemäß bei vergilbten und verschmutzten Bildwänden wesentlich.
Irrtümlicherweise wurde bisher angenommen, Plastikwände seien abwaschbar. Ein Versuch zeigt jedoch, daß die auf der Bildwand befindliche Fettschicht - verursacht durch Temperaturunterschiede im Raum, Ausatmungen und Ausdünstungen der Besucher usw. - zwar mit dem Auge kaum wahrnehmbar ist, beim Abwaschen mit Wasser aber wolkig zum Vorschein kommt und die Bildwand „scheckig" macht.
Selbst durch mühevolles und stundenlanges Abwaschen der Bildwand ist in der Entfernung von Oberflächenstaub kein Erfolg zu verzeichnen, da das stark vergilbte Material selbst unter Zuhilfenahme der schärfsten Reinigungsmittel, wie Scheuersand und Bürste gelb bleibt und nicht wieder weiß wird.
Ich habe kürzlich von Ratschlägen und Meinungen zu diesem Problem gelesen, die ich beim besten Willen auf Grund meiner praktischen Erfahrungen nicht akzeptieren kann, da eine Bildwand einzig und allein nur durch eine fachgerechte Aufarbeitung - soweit es die so wichtige Reflexion betrifft - wieder in fabrikneuen Zustand versetzt werden kann.
Da diese Spezialarbeiten seit Jahren selbst in den größten und bekanntesten Filmtheatern Deutschlands mit Erfolg und Garantie ausgeführt werden, hat der Theaterbesitzer zusätzlich die Gewähr, daß die Behandlung der Bildwand dem neuesten technischen Stand entspricht.
Durch ein besonderes Verfahren bleiben bei der Bearbeitung sämtliche Poren offen, so daß die Tondurchlässigkeit hundertprozentig gewährleistet bleibt. Selbst alte und fleckige weiße Bildwände brauchen jetzt nicht mehr durch kostspielige Neuanschaffungen ersetzt zu werden.
Die hierfür speziell abgestimmten Farben mit hohem Reflexionsvermögen ermöglichen es jetzt, mit geringeren Stromstärken bei der Kinoprojektion auszukommen.
Vorhangzüge niemals ölen
Um Bildwände vor weiteren Schäden anderer Art, z. B. Ölflecke, zu schützen, sei darauf hingewiesen, daß Vorhangzüge niemals geölt, sondern grundsätzlich zur Erzielung eines ruhigen und störungsfreien Laufes mit Staufferfett geschmiert werden sollen, da hierbei weniger die Gefahr besteht, daß die Bildwand durch das Herabtropfen von Fett verunreingt wird.
Schon wieder der "gewissenhafte" Vorführer ........
.
- Anmerkung : Wer lügt sich da etwas in die eigene oder fremde Tasche ???
.
Ein "gewissenhafter" Vorführer sollte es sich zur Pflicht machen, den Zustand der Bildwand ständig zu überwachen und in gewissen Zeitabständen den Theaterbesitzer oder Theaterleiter darauf hinweisen, daß eine Neuaufarbeitung wieder erforderlich ist, um ein einwandfrei helles Bild projizieren zu können.
Kein Unberufener sollte - verleitet durch unsachgemäße Ratschläge und Theorien - versuchen, das Reinigen oder Abwaschen der Bildwand auszuführen, da hierbei die Gefahr besteht, daß beim Mißlingen dieser Prozedur die Bildwand zeitweise nicht mehr verwendbar ist und daher Vorstellungen ausfallen müssen.
Außerdem sollte jede Putzfrau darüber informiert werden, daß beim Reinigen der Bühne weder Schrubber noch Besen an der Bildwand - z. B. beim Auswringen des Putzlappens - abgestellt werden dürfen. Die heute auf dem Markt befindlichen verschiedenartigen Fabrikate von Bildwandmaterialien, die in ihrem Reflexionsvermögen sehr unterschiedlich und dementsprechend empfindlich sind, bedürfen selbstverständlich einer jeweiligen Sonderbehandlung.
Um diese Arbeiten an Ort und Stelle ausführen zu können, ist es erforderlich, daß für diese Behandlung - wie auch für sonstige Arbeiten - im Filmtheater geeignete und entsprechend hohe Stehleitern vorhanden sind, was leider nur in wenigen Fällen zutrifft. Wie häufig müssen unzulängliche Leitern mit provisorischen Verstrebungen gesichert werden, um dem mit der Ausführung dieser Arbeiten Beauftragten in 5 bis 6 m Höhe einen unfreiwilligen „Sturzflug" zu ersparen.
Jede Arbeit läßt sich nur dann "gewissenhaft" und gut ausführen, wenn die entsprechenden Arbeitsgeräte auch vorschriftsmäßig vorhanden sind oder zur Verfügung gestellt werden." Paul Weigel (von der Spezialfirma für Bildwandaufarbeitungen) = Ein Leserbrief als EIgenwerbung !.
Harmonie bei der Tonwiedergabe
An jede akustische Anlage wird die Forderung nach einer harmonischen Klangwiedergabe gestellt.
.
- Anmerkung : Hier wird schon mal ungeschickt die Tonwiedergabe und die Klangwiedergabe in einen Topf geworfen. Auch der nachfolgende Text ist nicht überall korrekt.
.
Hierzu ist es erforderlich, daß die hohen, wie auch die tiefen Frequenzen gleichermaßen übertragen werden. Ein Übermaß an hohen oder tiefen Frequenzen würde dem Hörer einen blechernen bzw. dumpfen Klangeindruck vermitteln. In diesem Fall wird eine Beschneidung der Höhen bzw. Tiefen erforderlich. (Anmerkung : Diese Logik habe ich nicht verstanden.)
Um hierfür einen in der Praxis anwendbaren Maßstab zu erhalten, sah mjan sich gezwungen, eine sog. „mittlere Tonfrequenz" zu finden, die dem Klangempfinden des menschlichen Ohres entspricht; d. h, es mußte der Mittelpunkt zwischen dem tiefsten und höchsten, dem menschlichen Ohr wahrnehmbaren Ton gefunden werden.
Bei nur oberflächlicher Betrachtungsweise scheint dieses recht einfach zu sein, wenn man unüberlegt die im Durchschnitt dem Ohr wahrnehmbare Höchstfrequenz von etwa 16.000 Hz halbiert und so zu einer Mitte von 8000 Hz gelangt.
.
Die tatsächliche mittlere Tonfrequenz
In Wirklichkeit liegen die Dinge jedoch vollkommen anders. Die Spezialisten haben herausgefunden, daß z. B. zwischen den Frequenzen 100 Hz und 1000 Hz eine wesentlich größere Tondifferenz besteht, als etwa zwischen 10.000 Hz und 11.000 Hz. Man erkennt hier, daß die Frequenzunterschiede bei den tiefen Tönen wesentlich geringer sind, als bei den hohen Tönen.
Zur Festlegung der tatsächlichen mittleren Tonfrequenz muß daher die Frequenzskala den Tonwerten entsprechend eingeteilt werden, so wie es etwa von der Musik her bekannt ist. Man bedient sich hierzu der Oktaven.
Die Frequenz des gleichen Tones verdoppelt sich jeweils von Oktave zu Oktave. Wenn man das berücksichtigt, muß die Frequenzskala also wie folgt unterteilt werden:
16 000 - 8000 - 4000 - 2000 - 1000 - 500 - 250 - 125 - 63 - 32 - 16 Hz.
Als Mittelpunkt ist einwandfrei die Frequenz von 1000 Hz zu erkennen, die also die tatsächliche mittlere Tonfrequenz darstellt, zumindet bei einem Manschen, dessen Ohr ein Frequenzband von 16 bis 16.000 Hz wahrnimmt.
Somit kann jede errechnete mittlere Tonfrequenz nur rein theoretischen Charakter haben, da ja von Mensch zu Mensch nicht unwesentliche Unterschiede in bezug auf die Wahrnehmung von Tönen bestehen.
Beispielsweise kann ein junger Mensch bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr noch (beser = vermutlich) Frequenzen bis 20.000 Hz hören, während bei einem Achtzigjährigen die obere Grenze bei 5000 bis 6000 Hz liegt.
So hat man sich in Deutschland auf eine mittlere Tonfrequenz von 800 Hz geeinigt, während z. B. in den USA die oben ermittelten 1000 Hz als Mitte festgelegt wurden. Die mittlere Tonfrequenz ist individuell unterschiedlich. Sie liegt irgendwo zwischen 600 Hz und 1200 Hz.
.
Korrigieren mit dem Baß- und Höhen-"regler" (besser "Steller")
Aus dem oben Gesagten ist der Grund dafür zu erkennen, warum an vielen Verstärkeranlagen Baß- und Höhen"regler" angebracht wurden, mit denen die bei der Konstruktion und beim Bau einer elektroakustischen Anlage so hart erkämpften Höhen und Tiefen wieder beschnitten werden, weil z. B. zu wenig tiefe Frequenzen übertragen werden und nun ein Übermaß an hohen Frequenzen die Tonübertragung schrill erscheinen läßt.
Der Grund für das Fehlen bestimmter Frequenzen ist nicht unbedingt auf einen Fehler in der elektroakustischen Apparatur zurückzuführen; er liegt wohl in den meisten Fällen am Tonträger. Jedenfalls sollte auch besonders im Filmtheater auf ein harmonisches Klangbild geachtet und das Frequenzband der Tonanlage unter Berücksichtigung des oben Gesagten abgestimmt werden, d. h. oberhalb und unterhalb der mittleren Tonfrequenz soll sich die gleiche Anzahl von Oktaven befinden.
Es würde zu weit führen, die Verstärkeranlage bei den unterschiedlichen Tonträgern, in diesem Fall also meistens die Dichttonspur der Kopien, einzeln zu regulieren. Vielmehr sollten die niedrigste und höchste Frequenz, die die Anlage in der Lage ist, zu übertragen und wiederzugeben, in Einklang zueinander gebracht werden. W. Ankenbrand
Grundlagen der Optik: Das Licht - Oktober 1963
Für den Filmvorführer ist das Licht ein wesentlicher Faktor seiner Arbeit. Die Lehre vom Licht ist die Optik; sie umfaßt die physikalischen Erscheinungen, die auf den Gesichtssinn wirken.
Im Zusammenhang mit der Kinotechnik interessiert im wesentlichen die geometrische Optik. Hierunter versteht man die Erscheinungen, die auf der gradlinigen Ausbreitung der Lichtstrahlen beruhen, ohne dabei die Natur des Lichtes zu berücksichtigen. Sie behandelt die Eigenschaften von Linsen und Spiegeln, Reflexion und Brechung sowie das Zustandekommen optischer Bilder, also Begriffe, die zum Grundwissen des Vorführers gehören.
Das sichtbare Licht besteht aus elektromagnetischen Schwingungen sehr kleiner Wellenlänge zwischen 0,00037 mm (violett) und 0,00077 mm (rot).
Dazwischen liegen alle Spektralfarben, wie sie z. B. im Sonnenlicht enthalten sind, während die künstlichen Lichtquellen meist nur einen Teil abstrahlen. Die Theorie der elektromagnetischen Lichtstrahlung gehört in den Bereich der Wellen- bzw. Quantenoptik und soll hier nicht weiter interessieren.
- Anmerkung : Als Albert Einstein - damals bereits kurz vor dem 90zigsten Lebensjahr - gefragt wurde, ob es denn überhaupt etwas gäbe, das er nicht verstanden habe, so antwortete er : Ja, das mit dem Licht, das habe ich bis heute nicht verstanden.
Wichtig ist jedoch das Wissen von der gradlinigen Ausbreitung des Lichtes, solange es sich im optisch gleichen „Mittel" befindet. Diese Erscheinung läßt sich deutlich machen, wenn man Licht durch ein kleines Loch in einen dunklen Raum fallen läßt. Auch der Lichtkegel, der aus dem Objektiv des Projektors austritt, zeigt die gradlinige Ausbreitung des Lichtes.
Reflektion von Lichtstrahlen
Den Weg des Lichts nennt man Lichtstrahl, da man ihn sich von einem Anfangspunkt aus in einer Richtung unbegrenzt weiter denken kann. Auch bei einem schmalen Lichtbündel spricht man noch von einem Lichtstrahl.
Jeder Körper, den wir sehen, wird von Lichtstrahlen getroffen. Er wird dadurch sichtbar, daß er die Lichtstrahlen entweder reflektiert oder absorbiert. Auch die verschiedenen Farben entstehen durch Reflextion oder Absorption. Trifft farbiges Licht auf unser Auge, so wird in diesem ein bestimmter Earbreiz ausgelöst. Dieser Farbreiz wird vom Nervensystem in das Gehirn weitergeleitet und bewirkt dort eine bestimmte Farbempfindung.
Dichte und Farbe sind ihrem Wesen nach völlig verschieden. So kann eine Farbempfindung auch durch einen anderen Reiz der Sehnerven, wie etwa Druck oder Schlag zustandenkommen. Im Sonnenlicht, sind wie erwähnt, alle Farben enthalten. Um die Farbe „Weiß" zu erzeugen, sind aber nicht unbedingt alle Farben erforderlich. Treffen Lichtstrahlen auf eine glatte, polierte Fläche, so werden sie von dieser in einer bestimmten Richtung zurückgeworfen.
Zum Nachweis des Reflexionsgesetzes läßt man ein Lichtbündel schräg durch ein Loch in einen senkrecht aufgespannten Schirm fallen. Unter dem Schirm befindet sich ein waagerechter Spiegel, der das auffallende Licht zurückwirft. Durch Einblasen von Zigarettenrauch wird der Strahlenverlauf sehr schön deutlich. Der eintreffende Lichtstrahl E trifft im Punkt A auf den Spiegel und wird in Richtung R reflektiert. Beide Strahlen liegen in einer Ebene. Durch Messung findet man, daß der Winkel zwischen dem auftreffenden Strahl und der Senkrechten L genau so groß ist wie der Winkel zwischen dem reflektierten Strahl und der Senkrechten, d. h. der Reflexionswinkel ist gleich dem Einfallswinkel.
Außer dieser regelmäßigen Reflextion oder Spiegelung gibt es im Gegensatz dazu die unregelmäßige oder diffuse Reflexion. Sie tritt ein, wenn die Oberfläche des reflektierenden Körpers uneben ist. Das Licht wird dann nach allen Seiten zurückgeworfen.
Bei genauer Untersuchung wird man aber auch hier die Gültigkeit des Reflexionsgesetzes herausfinden. Zerlegt man nämlich die Oberfläche des Körpers in genügend kleine Teilflächen, so sind diese Teilflächen als Ebenen anzusehen. Da aber jedes dieser Flächenelemente in bezug auf die Mittellinie eine andere Lage hat, wird es auch jeweils das Licht in eine andere Richtung zurückwerfen; es tritt also eine Zerstreuung des Lichtes ein.
In der Praxis trifft der Vorführer die Reflexion z. B. bei den Bildwänden an. Man unterscheidet hier bekanntlich diffus strahlende Wände mit einem Streuwinkel von ca. 160° und sog. Reflexwände mit einem Streuwinkel von etwa 50°. Bei der ersten Wand liegt also die unregelmäßige, bei der zweiten die regelmäßige Reflexion vor.
.
Brechung und Beugung
Außer der Reflexion gibt es noch die Brechung oder Refraktion der Lichtstrahlen. Jeder kennt die Erscheinung, daß ein Bleistift, der schräg in das Wasser gehalten wird, abgeknickt erscheint. Auch das läßt sich durch einen Versuch erläutern, indem man ein Lichtbündel durch ein Loch in einem undurchsichtigen Schirm schräg auf eine Wasseroberfläche fallen läßt.
Hierbei kann man beobachten, daß ein Teil des auffallenden Lichtes entsprechend dem Reflexionsgesetz reflektiert wird. Der andere Teil des Lichtbündels dringt in das Wasser ein, wird aber an der Eintrittsstelle aus seiner Richtung abgelenkt, d. h. gebrochen.
Im Wasser läuft der Strahl dann gradlinig weiter. Verändert man die Neigung des einfallenden Lichtstrahles, so wird die Brechung um so größer, je schräger der Strahl auf die Oberfläche des Wassers auftrifft. Andererseits tritt keine Brechung ein, wenn der Lichtstrahl senkrecht in das Wasser eintritt.
Eine solche Richtungsänderung oder Brechung des Lichtstrahls läßt sich immer beobachten, wenn der Lichtstrahl die Grenzfläche zweier durchsichtiger Mittel durchdringt. Der gebrochene Strahl liegt mit dem einfallenden Strahl und dem Einfallslot in einer Ebene. Wird der Lichtstrahl zum Einfallslot hin gebrochen, so sagt man, der zweite Stoff sei optisch dichter; wird der Strahl vom Einfallslot weg gebrochen, heißt der zweite Stoff optisch dünner. Die Ursache der Brechung liegt in der Geschwindigkeitsänderung, die der Lichtstrahl an den Grenzflächen der beiden optischen Mittel erfährt.
Eine „Beugung" der Lichtstrahlen tritt immer dann auf, wenn ein Lichtstrahl durch eine im Verhältnis zur Wellenlänge kleine Öffnung fällt. Der Strahl geht dann nach dem Passieren dieser Öffnung nicht gradlinig weiter, sondern er wird fächerartig zerstreut. Eine Erklärung dieser Erscheinung ist allerdings nur mit Hilfe der Wellentheorie des Lichtes möglich. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß die meisten Lichterscheinungen, wie die Wirkungsweise der Linsen, die Erzeugung optischer Bilder, wie überhaupt die Projektionstechnik auf der gradlinigen Lichtausbreitung und den vorbeschriebenen optischen Erscheinungen beruht. G. E. Wegner
Grundlagen der Optik - hier 2 Bilder
Illustrationen zu: „Grundlagen der Optik: Das Licht" in FV 10/63, Seite 8. Oben ist dargestellt, wie ein Lichtstrahl an einer ebenen Fläche reflektiert wird. Der Winkel des einfallenden Strahles E zur Senkrechten L ist gleich dem Ausfallwinkel zwischen L und R.
Die untere Zeichnung erläutert die Brechung eines Lichtstrahles beim Eintritt in ein anderes Medium. (Zeichnungen: G. E. Wegner)
Laudatio : Dr. e. h. August Arnold
Am 12. September 1963 konnte der verdiente Filmpionier Dr. e. h. August Arnold, Mitinhaber der Fa. Arnold & Richter KG, München, seinen 65. Geburtstag begehen. Schon seit seinem 17. Lebensjahr mit der filmtechnischen Entwicklung verbunden, hat August Arnold im Laufe seiner weiteren beruflichen Tätigkeit Leistungen hervorgebracht, ohne die der heutige Stand der internationalen Film-, Kino- und Fernsehtechnik kaum denkbar wäre.
Seine ersten praktischen Erfahrungen sammelte er als Kameramann bei über 100 selbstgedrehten Spielfilmen und gründete im Jahre 1917 gemeinsam mit Dr. R. Richter die weltbekannte Firma Arnold & Richter KG, die Heute zu dem umfangreichen ARRI-Gebäudekomplex in der Türkenstraße in München herangewachsen ist.
Bereits im Jahre 1918 wurde von August Arnold die erste Filmkopiermaschine entwickelt und serienmäßig gebaut. Von hier aus trat auch die bekannte ARRIFLEX 35 als erste Spiegelreflexkamera ihren Siegeszug durch die Welt an. In den folgenden Jahren konnte das Lieferprogramm der Firma bedeutend erweitert werden; es umfaßt heute außer den Kameras für 35- und 16mm-Film auch Film- und Bühnenbeleuchtungsgeräte, Film-Entwicklungs- und Kopiermaschinen und Geräte für die Filmbearbeitung.
Dr. Arnold war in jüngster Zeit auch maßgebend an der Entwicklung des Electronic-Cam-Verfahrens beteiligt. Als Anerkennung für seine Pionierarbeit wurde August Arnold im Jahre 1951 mit der Oskar-Messter-Medaille der DKG und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Am 21. Juni 1963 wurde ihm durch die TH München der Titel „Dr.-Ing. e. h." verliehen. -Z-
Die Titel-Seite von Heft 11/1963 (November 1963) - 10. Jahrgang
"Bessere Ausnutzung großer Theater"
Aus der Zeit der »Filmpaläste« gibt es bekanntlich noch eine große Anzahl von Filmtheatern mit über 1.000 Sitzplätzen, die infolge der Stagnation im Filmtheaterbetrieb eine ungenügende Besucherfrequenz aufweisen und unwirtschaftlich arbeiten.
Man ist daher schon seit einigen Jahren dazu übergegangen, solche Häuser dadurch besser auszunutzen, daß man sie in zwei Theater aufteilt. Auf diese Weise entstanden die sog. »Bikinos«, deren wesentliches Merkmal darin besteht, daß nach einem entsprechenden Umbau zwei Zuschauerräume übereinander liegen, die jeder für sich tragbare und wirtschaftliche Sitzplatzzahlen aufweisen.
Auch bei Theaterneubauten der letzten Zeit wurde vielfach dieses Prinzip mit Erfolg angewendet, da es neben den vorgenannten wirtschaftlichen Vorteilen auch solche technischer Art bietet. Je nach den räumlichen Verhältnissen wird dabei so vorgegangen, daß der frühere Vorführraum für das kleinere neue Theater verwendet wird; eine Lösung, die sich vor allem bei ehemaligen Rangtheatern anbietet, da in diesem Fall die ansteigend angeordneten Rangsitzplätze den neuen Zuschauerraum bilden können. Der Parkettraum des früheren großen Hauses bildet dann den Zuschauerraum für das größere der beiden neuen Theater.
In projektionstechnischer Beziehung ergeben sich durch eine solche Lösung besondere Vorteile, weil sowohl von dem alten Vorführraum aus, wie von dem neu unten anzulegenden zweiten Vorführraum aus angenäherte Horizontal-Projektion ermöglicht wird, was besonders bei Breitwand- und CinemaScope-Wiedergabe von besonderer Bedeutung ist. Bei Neubauten solcher »Kombi-Theater« kann auch ein gemeinsamer Vorführraum für beide Theater verwendet werden.
Die Leuchtstofflampe im Filmtheater - November 1963
Obwohl bei der Installation einer Leuchtstofflampe ein größerer technischer Aufwand erforderlich ist, als bei der herkömmlichen Glühlampe, erfreut sie sich einer steigenden Beliebtheit. Ihre weite Verbreitung - auch im Filmtheaterbetrieb - verdankt sie zwei grundsätzlichen Vorteilen: relativ günstiger Wirkungsgrad und tageslichtähnlichere Lichtfarbe.
Trotz der steigenden Verwendung von Leuchtstofflampen für die verschiedensten Beleuchtungszwecke herrscht jedoch über ihr Prinzip und ihre Funktion in weiten Kreisen noch Unklarheit, insbesondere auch deshalb, weil die Vorgänge im Innern der Lampe ziemlich kompliziert sind.
.
Prinzip und technische Einzelheiten
Die Leuchtstofflampe besteht in ihrem Aufbau aus einer Glasröhre, die an ihren Öffnungen mit zwei Kappen luftdicht verschlossen wird. Aus diesen Kappen ragen jeweils zwei Kontaktstifte, an denen an jedem Ende des Rohres eine Doppelwendel aus Wolfram angebracht ist, ähnlich denen, wie sie bei der Glühlampe Verwendung finden. Diese Wendeln bezeichnet man als Elektroden.
Im übrigen ist das Glasrohr mit Quecksilberdampf und einer geringen Menge des Edelgases Argon unter einem Druck von 0,1 Torr angefüllt. Hier von einem Druck zu sprechen, ist eigentlich nicht sehr überzeugend, denn erst 760 Torr ergeben eine Atmosphäre, also den normalen Druck, der auf der Erdoberfläche zu finden ist.
Innerhalb der Leuchtstofflampe herrscht also ein relativer Unterdruck von fast einer Atmosphäre. Man rechnet die Leuchtstofflampe deshalb zu den Niederdruck-Gasentladungslampen.
Damit die Leuchtstofflampe strahlt ....
Um die Leuchtstofflampe zur Strahlung zu veranlassen, ist es nötig, einen Elektronenfluß zwischen den beiden Elektroden zustande zu bringen, wie es z. B. auch bei der Elektronenröhre der Fall ist (siehe FV 5/63, Seite 5, „Wirkungsweise der Elektronenröhre").
Wie bei der Elektronenröhre nennt man die negative, Elektronen aussendende Elektrode, die Kathode, die positive, die Elektronen empfangende die Anode.
Um einen Elektronenaustritt aus der Kathode zu ermöglichen, muß diese erhitzt werden. Da aber die Leuchtstofflampe mit Wechselstrom gespeist wird, ist jede Elektrode bei z. B. 50-periodigem Wechselstrom 50mal in der Sekunde Kathode und 50 mal Anode. Es ist also erforderlich, beide Elektroden der Leuchtstofflampe zu erhitzen. Um die Glühtemperatur der Wendeln möglichst niedrig zu halten und die Zündung zu erleichtern, wurde das Argon mit in das Rohr eingefüllt, da es den Elektronenfluß wesentlich begünstigt.
Aber auch dann würden aus den Wolfram-Wendeln noch keine Elektronen austreten. Die Wendeln müssen erst mit einer auf sie aufgetragenen Paste aus Erdkali-Oxyden aktiviert werden. Diese Paste ist einem Verschleiß unterworfen. Wenn sie verbraucht ist, ist die Leuchtstofflampe nicht mehr verwendbar.
Die Leuchtstofflampe zünden
Um auf besondere Heizstromkreise für die Elektroden verzichten zu können, legte man parallel zur Lampe, aber in Serie mit den Wolfram-Wendeln einen sogenannten „Zünder". Wird an die Leuchtstofflampe eine Spannung angelegt, so kann zwischen den beiden Elektroden noch kein Elektronenfluß zustande kommen, da aus den noch kalten Elektroden keine Elektronen austreten können.
Die volle, nur durch den Widerstand der Wendeln geminderte Spannung wirkt nun auf den Zünder ein. Dieser kann diesem plötzlichen Stromstoß nicht widerstehen und schließt für einen kurzen Moment den Stromkreis über die erste Wendel, den Zünder und dann die zweite Wendel.
Dieser kurze Augenblick genügt aber, um die Wendeln zum Glühen zu bringen. Durch die nun aus den Wendeln austretenden Elektronen schließt sich der Kreis über die Lampe. Da die Elektronen aber, bevor sie den gasgefüllten Raum im Glasrohr durchfliegen, die Wendeln passieren müssen, werden diese auf der erforderlichen Glühtemperatur gehalten. Die jetzt von der einen Elektrode zur anderen fliegenden Elektronen prallen unterwegs mit ungeheurer Wucht auf die in der Glasröhre befindlichen Quecksilberatome.
Dadurch wird aus dem Atomaufbau ein gebundenes Elektron gewissermaßen herausgeschossen. Dieses kehrt jedoch sofort wieder zu seinem Atom zurück, da es ja dessen fester Bestandteil ist.
Durch diesen kurzzeitigen Ausflug des Elektrons wird eine Energie frei, die zu 38% aus ultraroter (Wärme-)Strahlung, zu 60% aus ultravioletter und nur zu 2% aus sichtbarer Lichtstrahlung besteht.
Wie kommt der Wirkungsgrad zustande
Die eingangs aufgestellte Behauptung, die Leuchtstofflampe habe einen guten Wirkungsgrad, mag bei dieser geringen Menge von nur 2% Lichtenergie unsinnig erscheinen, da die Glühlampe immerhin ca. 5% der zugeführten Energie in Licht umwandelt. Die entstehenden 38% Wärme aber sind oft unerwünscht und die unsichtbare UV-Strahlung kann noch nicht einmal den Glaskörper der Lampe durchdringen, es sei denn, man würde diesen aus teurem Opalglas herstellen.
Trotzdem wird gerade sie zur Lichterzeugung herangezogen. Auf die Innenwandung des Glasrohres wird nämlich ein Leuchtstoff aufgebracht, der die Eigenschaft besitzt, die kurzwelligen UV-Strahlen in die langwelligeren Strahlen des sichtbaren Lichtes umzuformen. Man nennt diese Erscheinung Lumineszenz.
Der Leuchtstoff besteht großenteils aus Kalziumwolframat, Zinksilikat, Kadmiumborat und Kadmiumsilikat. Durch unterschiedliche Mischung dieser Bestandteile ist es möglich, die Lichtfarbe zu verändern.
Man unterscheidet „Tageslichtweiß" mit einer Farbtemperatur von 6.500 Grad Kelvin, „Weiß" mit 4.500 Grad Kelvin und „Warmton" mit 3.000 Grad Kelvin.
Durch Ausnutzung der UV-Strahlung zur Lichterzeugung hat sich der Wirkungsgrad der Leuchtstofflampe auf etwa 20% erhöht. Die Lichtausbeute liegt je nach Leistungsaufnahme zwischen 30 und 50 Lumen je Watt.
Demgegenüber beträgt die Lichtausbeute der Glühlampe nur 8 bis 12 Lumen je Watt. Ein weiterer Vorteil der Leuchtstofflampe ist die geringe Leuchtdichte von nur ca. 0,4 Stilb. Dadurch ist es möglich, die Lampe auch so anzubringen, daß sie dem Blick direkt zugänglich ist, ohne die Gefahr einer Blendung befürchten zu müssen.
Bilder
Leuchtstofflampen in Ringform, die ebenfalls in verschiedenen Wattstufen und Abmessungen geliefert werden, geeignet für Einbau-Deckenbeleuchtungen. (Foto: OSRAM)
U-förmige Leuchtstofflampen verschiedener Wattstufen und Abmessungen für den Einbau in Leuchten und für dekorative Zwecke. (Foto: OSRAM)
Drosselschaltung einer Leuchtstofflampe. D = Drosselspule, K = Kompensations-Kondensator (soweit erforderlich), Kg = Entstörkondensator (nur bei Glimmzünder), L = Leuchtstofflampe, St = Starter, V = Vorschaltgerät. (Zeichnung: OSRAM)
Schaltungsanordnung bei zwei hintereinander geschalteten Leuchtstofflampen (Duoschaltung). D = Drossel, L = Leuchtstofflampen, K = Kondensator mit Entladewiderstand von 1 M-Ohm, Kg = Entstörkondensator, St = Starter, V = Vorschaltgerät. (Zeichnung: OSRAM)
.
Der „Stroboskopische Effekt"
Trotzdem weist die Leuchtstofflampe auch Nachteile auf. Neben den eingangs erwähnten Investitionskosten, die durch die Vorschaltdrossel und die bei größeren Anlagen notwendige Blindstromkompensation verursacht werden, tritt u. a. noch der sogenannte „Stroboskopische Effekt" unliebsam in Erscheinung.
Hierunter versteht man ein Flimmern in doppelter Netzfrequenz. Es dürfte bekannt sein, daß bei z. B. 50-periodigem Wechselstrom die Stromrichtung 50mal in der Sekunde wechselt. Zwischen jedem Wechsel ist aber die anliegende Spannung gleich null. Bei einem Wechselstrom von 50 Hz finden 100 Wechsel je Sekunde statt, d. h. lOOmal in der Sekunde ist die angeschlossene Leuchtstofflampe stromlos, lOOmal in der Sekunde findet also auch kein Elektronenfluß zwischen den beiden Elektroden statt.
Ohne Elektronenfluß entsteht aber auch keine Strahlung und die Leuchtstofflampe ist vollkommen dunkel. Das so entstehende Flimmern fällt zwar dem Auge kaum auf und kann bei der Beleuchtung von Wohn-, Schreib- und ähnlichen Räumen ohne weiteres hingenommen werden.
Anders liegen die Dinge aber bei der Beleuchtung von Werkstätten usw. sich drehende Räder und andere sich rhythmisch bewegende Teile können dem Auge stillstehend oder mit entgegengesetzter Bewegungsrichtung erscheinen.
Welche Gefahren dadurch entstehen, wird man sich vorstellen können. Doch kann man den stroboskopischen Effekt durch geeignete Maßnahme mildern oder völlig verhindern, z. B. dadurch, daß man stärker phosphoreszierende Leuchtstoffe verwendet.
Die Phosphoreszenz
Phosphoreszenz ist ein Unterbegriff der Limineszenz. Geben die Leuchtstoffe nur dann sichtbares Licht ab, wenn sie einer UV-Bestrahlung ausgesetzt sind, spricht man von Fluoreszenz, hält die Lichtstrahlung auch noch eine Zeitlang nach Ende der UV-Strahlung an, nennt man dieses Phosphoreszenz.
Ein weiterer Nachteil ist die Temperaturabhängigkeit der Leuchtstofflampe. Bei Temperaturen unter -10 Grad Celsius ist ein einwandfreier Betrieb nicht mehr gewährleistet, ein Umstand, der die Leuchtstofflampe für Außenbeleuchtungen größtenteils ungeeignet macht.
Trotzdem ließ sich die immer größer werdende Verbreitung der Leuchtstofflampe nicht aufhalten, wenngleich es ihr auch nicht gelingen kann, die gute alte Glühlampe vollkommen zu verdrängen. Das große Angebot in verschiedenen Formen und Größen, sowie die Möglichkeit der Wahl unter drei unterschiedlichen Lichtfarben machen die Leuchtstofflampen für unzählige Beleuchtungsaufgaben zu der z. Z. idealsten Lichtquelle. Die beigefügten Abbildungen zeigen verschiedene Ausführungsformen von Leuchtstofflampen. A-d
Merkmale elektrischer Widerstände - November 1963
Jeder Stoff ist aus unzähligen kleinen Teilchen zusammengesetzt, die Atome genannt werden. Das Wort „Atom" kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich „das Unteilbare". Obwohl ein Atom einen unvorstellbar kleinen Durchmesser hat, läßt es sich seinem Namen zum Trotz doch weiter aufteilen in mehrere noch kleinere Teilchen, nämlich in den aus Protonen und Neutronen bestehenden Atomkern und in die den Kern umgebenden Elektronen.
Die Bedeutung der Elektronen
Diese Elektronen sind für die Elektrotechnik sehr wichtig; nicht nur, weil sie Träger des elektrischen Stromes sind. Ihre Anzahl ist in einem Stoff auch dafür ausschlaggebend, ob und in welchem Ausmaß dieser als Leiter des elektrischen Stromes geeignet ist.
Man unterscheidet zwei Gruppen von Elektronen und zwar die fest zum Schalenaufbau des Atoms gehörenden und die „freien Elektronen", die nicht unbedingt an ein Atom gebunden sind. Nur diese freien Elektronen kommen als Trägerteilchen des elektrischen Stromes in Betracht.
Wenn sich also in einem Stoff keine freien Elektronen befinden, kann dieser auch keinen Strom leiten und wird daher als „Nichtleiter" bezeichnet. Die leitenden Stoffe, in denen freie Elektronen vorhanden sind, heißen dementsprechend „Leiter".
Wird ein solcher leitender Stoff von einem elektrischen Strom durchflossen, so darf man sich diesen Vorgang nicht so vorstellen, daß die Elektronen bequem durch diesen hindurch „kullern". Vielmehr müssen sie sich mehr oder minder mühsam zwischen den Atomen hindurchzwängen, d. h. den fließenden Elektronen wird ein „Widerstand" entgegengesetzt.
Die Größe dieses Widerstandes hängt - sieht man von der stofflichen Beschaffenheit des Leiters ab - von dessen Qualität und Länge ab. Durch einen Leiter mit großem Querschnitt können sich naturgemäß die Elektronen wesentlich leichter „hindurchschlängeln", als durch einen Leiter mit kleinem Querschnitt. Außerdem werden sie auf einem langen Weg mehr behindert, als auf einem kurzen Weg.
.
Eigenschaften des elektrischen Widerstandes
Die Maßeinheit für den elektrischen Widerstand ist das „Ohm" (Kurzzeichen Q = Omega), so benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm. Als Formelzeichen wählte man „R" (nach dem griechischen Wort „Rheostat"), das an sich einen veränderlichen (variablen) Widerstand bezeichnet.
Ein „Ohm" ist der Widerstand, den eine Quecksilbersäule von 1063mm Länge und 1qmm Querschnitt bei einer Temperatur von 0° Celsius (C) den Elektronen entgegensetzt.
Der elektrische Widerstand der verschiedenen Stoffe ist nicht gleich. So leitet z. B. Silber den elektrischen Strom viel besser als Aluminium oder Eisen. Um eine Vergleichsmöglichkeit zu erhalten, ermittelte man einen „Einheitswiderstand" der leitenden Stoffe, den sogenannten „Spezifischen Widerstand" (Kurzzeichen = Rho).
Er wird gemessen bei einer Temperatur von 20°C an einer Leitung aus dem Werkstoff, die eine Länge von 1m und einen Querschnitt von 1qmm hat. Der wechselseitig bezügliche (reziproke) Wert des spezifischen Widerstandes ist die „Leitfähigkeit" (Kurzzeichen = Kappa).
Sie gibt an, wie lang eine Leitung mit einen Querschnitt von 1qmm bei einer Temperatur von 20°C sein muß, um einen Widerstand von 1 Ohm zu erhalten.
Die Maßeinheit für die Leitfähigkeit ist das „Siemens" (Formelzeichen S).
Die Berücksichtigung der Temperatur bei der Messung des spezifischen Widerstandes und der Leitfähigkeit ist wichtig, da sich der Widerstand der meisten Stoffe mit der Temperatur verändert.
Um auch dafür einen Maßstab zu erhalten, wurde der „Temperaturwert" oder Temperatur-Koeffizient der Leiterstoffe ermittelt (Kurzzeichen = Alpha). Er gibt an, um wieviel Ohm sich der Widerstand des Stoffes je Grad Celsius, der über 20°C liegt, erhöht.
Der spezifische Widerstand von reinen Metallen nimmt mit fallender Temperatur stetig ab. Bis vor etwa 50 Jahren nahm man an, daß dieses auch bis zum „absoluten Nullpunkt" (-273,16° Celsius) der Fall sei. Im Jahre 1911 machte man jedoch die Entdeckung, daß der spezifische Widerstand des Quecksilbers zwar den bis dahin gültigen Gesetzen folgend bis -268,93° C gleichmäßig abnahm, jedoch beim weiteren Abkühlen um nur wenige hundertstel Grad bis auf einen nicht mehr meßbaren Wert verschwand. Dieser unter jeder Nachweisbarkeit liegende Widerstand bedeutet eine unendlich große Leitfähigkeit, d. h. praktisch die ideale Leitung.
Man konnte inzwischen ähnliche Eigenschaften auch bei anderen Metallen und Metallverbindungen feststellen. Gewisse Halbleiter können diesen Zustand erreichen, ohne besonders tiefen Temperaturen ausgesetzt zu sein. Man nennt die Werkstoffe in diesem Zustand des praktisch nicht mehr vorhandenen elektrischen Widerstandes „supraleitend". Natürlich ist dieses Verfahren in der Praxis im allgemeinen nicht anwendbar, aber von großer Bedeutung für Wissenschaft und Forschung.
Bild
Schaltzeichen von Ohmschen Widerständen: a) = ohmscher Widerstand allgemein, b) = rein ohmscher Widerstand, c) = stetig verstellbarer ohmscher Widerstand, d) = stufig verstellbarer ohmscher Widerstand, e) - stetig verstellbarer und ausschaltbarer ohmscher Widerstand (Kurzschaltzeichen), f) = stufig verstellbarer ohmscher Widerstand (Kurzschaltzeichen), g) = ohmscher Widerstand mit Anzapfungen. (Zeichnung: Ankenbrand)
.
Ausführungsarten elektrischer Widerstände
Der Widerstand von Leitungen ist einerseits eine unerwünschte Erscheinung (z. B. Spannungsverlust); andererseits bietet er jedoch auch mannigfaltige Vorteile. So findet er z. B. Verwendung als Bauelement in elektronischen, elektro-akustischen und nachrichtentechnischen Anlagen.
Da der Widerstand reiner Metalle sich mit steigender Temperatur erhöht, also nicht gleichbleibend ist, kommen diese als Werkstoff für Widerstände nicht in Betracht. Man verwendet deshalb für diesen Zweck Metallegierungen, die ihr Widerstandsmaximum bereits bei normaler Zimmertemperatur erreichen und daher von weiteren Temperaturveränderungen unabhängig sind.
Hierzu gehören Legierungen von Kupfer, Mangan, Chrom-Nickel und Silber. Sie haben den Vorteil, bei hohen Temperaturen nicht zu oxydieren; außerdem ist ihr spezifischer Widerstand hoch und bei Temperaturschwankungen einigermaßen konstant.
Eine andere Ausführungsart sind die „Schichtwiderstände", bei denen im Vakuum auf einen isolierenden Widerstandsträger, z. B. Keramik, eine Kohlenstoffschicht aufgedampft wird. Wenn diese Kohlenstoffschicht auf einen zylindrischen Widerstandsträger aufgebracht ist, kann der Schichtwiderstand durch das Einschleifen einer Wendel erhöht werden.
Sowohl Drahtwiderstände, wie auch Masse- und Schichtwiderstände, können als variable (veränderliche) Widerstände, z. B. Schiebewiderstände, ausgebildet sein. Sie können z. B. als „Potentiometer" (Spannungsteiler) verwendet werden, da jedes Ende und der Schleifkontakt mit einem Anschluß versehen sind. Auf jedem Widerstand wird der Ohmwert und die maximale Belastung angegeben; teilweise wird auch ein international gültiger Farbcode verwendet.
Zu den gebräuchlichen Widerständen gehören schließlich auch die „Thermistore" oder Heißleiter-Widerstände. Sie haben einen negativen Temperatur-Koeffizient, d. h. ihr Widerstand fällt mit steigender Temperatur. (Wir nennen diese Widerstände NTC und PTC Elemente)
Als Widerstandsmaterial wird hier Kupferoxyd-, Urandioxyd- und Magnesium-Titan-Spinell verwendet. Die beiden letzten haben jedoch den Nachteil, bei hoher Temperatur leicht zu oxydieren. Sie werden daher zum Schutz gegen den Luftsauerstoff in einen evakuierten oder gasgefüllten Glaskolben eingebaut, bzw. mit einer Glasur versehen.
.
Wirkungsweise und Anwendung - und die wichtigste Weisheit:
Schickt man einen elektrischen Strom durch einen Widerstand, so kann man einen Spannungsabfall, also eine Verminderung der elektrischen Energie beobachten.
- Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie ist jedoch bekannt, daß Energie niemals verloren geht; sie wird lediglich in eine andere Energieform umgewandelt. Das geschieht auch beim elektrischen Widerstand.
Da die Elektronen sich, wie eingangs angedeutet, mühsam durch das Atomgefüge durchkämpfen müssen, muß Energie anfgewendet werden, wobei sich die Spannung vermindert, die die Elektronen vorwärtstreibt.
Wenn die Elektronen an den Atomen „entlangscheuern", geraten die Atome in Bewegung und beginnen zu vibrieren. Diese Atombewegung wird durch die Gefühlsnerven der menschlichen Haut als Wärme empfunden. Diese Wärme
spürt man jedoch nicht nur bei unmittelbarer Berührung des durch einen Widerstand erwärmten Körpers, z. B. einer elektrischen Kochplatte, sondern auch noch in einiger Entfernung.
Die Atombewegung überträgt sich auch auf die Atome der Luft, wodurch ebenfalls die Sinnesorgane der Haut berührt werden, d. h. die durch einen Widerstand erzeugte Wärme wirkt nicht nur direkt bei körperlicher Berührung, sondern auch durch Strahlung in Form elektromagnetischer Wellen.
Zu dieser Strahlung werden die Atome durch ihre Bewegung veranlaßt, die ihnen in diesem Fall durch die Elektronen übertragen wird. Diese Erscheinung wird z. B. bei den elektrischen Wärmegeräten ausgenutzt.
Erhöht man den Elektronenstrom durch den Widerstand, so werden die Atombewegungen stärker und schneller. Dadurch entsteht eine stärkere Wärmestrahlung; außerdem erhöht sich auch durch das schnellere Vibrieren die Frequenz der ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen.
Diese kurzwelligeren Strahlen werden von unseren Sinnesorganen nicht mehr als Wärme empfunden, sondern als sichtbares Licht, d. h. der Widerstand beginnt zu glühen, wobei sich die Farbe mit steigender Temperatur von Rot bis Weiß ändert. Daher stellt auch die Wendel der Glühlampe nichts anderes dar, als einen sehr stark erhitzten Widerstandsdraht.
Abschließend sei noch erwähnt, daß Kohle, die übrigens wie die Thermistore einen negativen Temperatur-Koeffizient besitzt, ihren Widerstand nicht nur mit der Temperatur, sondern auch unter dem Einfluß eines mechanischen Druckes verändert. Wird sie einem solchen ausgesetzt, so verengt sich dadurch ihr Atomgefüge, was einer Widerstandserhöhung gleichkommt. Nach diesem Prinzip arbeiten z. B. die Kohle-Druckwiderstände und die Kohlemikrofone, wie sie u. a. in den Sprechkapseln der (uralten) Telefonhörer anzutreffen sind.
Der Vollständigkeit wegen sei noch auf die kapazitiven und induktiven Widerstände hingewiesen, die u. a. in der Verstärker-Technik eine Rolle spielen. Sie sind jedoch völlig anderer Natur und anderen Gesetzen unterworfen, so daß an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden soll. - Ankenbrand
.
Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit
| Stoff | Spez. Widerstand | Leitfähigkeit | |
| Aluminium | 0,029 | 34,5 | |
| Bogenlampenkohle (ohne Kupfermantel) | 60-80 | 0,02 | |
| Chromnickel | 1,0 | 1,0 | |
| Eisen | 0,098 | 10,2 | |
| Gold | 0,022 | 45,5 | |
| Konstantan | 0,49 | 2,05 | |
| Kupfer | 0,0178 | 56,0 | |
| Messing | 0,08 | 12,5 | |
| Nickelin | 0,4 | 2,5 | |
| Quecksilber | 0,958 | 1,04 | |
| Silber | 0,016 | 62,5 | |
| Wismut | 1,17 | 0,85 | |
| Wolfram | 0,053 | 18,9 | |
| Zink | 0,059 | 16,9 |
Temperatur-Koeffizient einiger Stoffe
| Stoff | Koeffizient | |
| Aluminium | 0,004 | |
| Eisen | 0,0046 | |
| Kupfer | 0,0038 | |
| Silber | 0,0038 |
Verdunkler für Leuchtstofflampen - November 1963
Leuchtstofflampen, wie sie u. a. von Osram und Philips hergestellt und geliefert werden, haben schon seit langer Zeit für die verschiedensten Beleuchtungszwecke eine steigende Verwendung gefunden, insbesondere dort, "wo" ein möglichst diffuses und für das Auge angenehmes Licht erwünscht ist, sowie auch zur Erzielung dekorativer Lichtwirkungen.
Infolge ihrer technischen Ausführung und der damit verbundenen Betriebsbedingungen war jedoch ihre Verwendung auf normale Raumbeleuchtung zunächst beschränkt, bis es gelang, auch für Leuchtstofflampen Verdunkelungs- Einrichtungen auf elektronischer Basis zu entwickeln, so daß sie auch als Zuschauerraum-Beleuchtung und überall dort eingesetzt werden konnten, "wo" eine vollständige oder teilweise Verdunkelung erforderlich ist oder gewünscht wird.
Elektronische Helligkeitssteuerung
Während bei Verdunkelungs-Einrichtungen von Beleuchtungsanlagen mit Glühlampen Widerstände oder Regulier-Transformatoren verwendet werden, um die Netzspannung für die Lampen und damit ihre Helligkeit herabzusetzen, erfolgt die Helligkeitssteuerung von Leuchtstofflampen auf elektronischem Wege.
Ein solches Verfahren wird z. B. von der Fa. Dr.-Ing. JOVY, Leer (Ostfriesland), angewendet, wobei mit Brenndauer-Verkürzung gearbeitet wird, d. h. der Momentanwert wird konstant gehalten und die Lampenbrenndauer durch verzögerte Aussteuerung der gittergesteuerten Röhren verkleinert.
Der Anschluß der Leuchtstofflampen erfolgt hierbei im üblicher Weise über eine Vorschaltdrossel mit einem zusätzlichen Heiztransformator, der die Elektroden der Leuchtstofflampe vorheizt. Dadurch wird eine Verringerung der Zündspannung erreicht; außerdem wird durch die Dauerheizung der Elektroden die Lebensdauer der Leuchtstofflampen verlängert.
Das Wichtigste bei der Helligkeitssteuerung von Leuchtstofflampen ist das sofortige Zünden, die Flackerfreiheit in allen Vendunklungsstadien und die Betriebssicherheit der Zündung.
Um das zu erreichen, wird - wie an anderer Stelle ausgeführt - eine kapazitive Zündhilfe in Form eines Zündstreifens benutzt, der aus einem blanken Kupferdraht besteht und an der Außenseite des Lampenrohres angebracht wird. Er ist mit den beiden Sockelenden der Lampe verlötet und geerdet. Durch diese Maßnahme wird die Feldverteilung entlang der Röhre festgelegt, so daß Metallteile, die sich in der Umgebung der Leuchtstofflampe befinden, auf die Zündsicherheit keinen Einfluß haben.
Nach dem oben angedeuteten Prinzip der Brenndauerverkürzung arbeiten z. B. die bekannten magnetischen Verdunkler, die aus einem Transduktor in Sättigungsschaltung in Verbindung mit zwei Siliziumzellen bestehen. Zum Ausgleichen der Lastabhängigkeit des Transduktors arbeitet der magnetische Verdunkler mit einer Spannungsrückführung, so daß sich Belastungsunterschiede auf die ausgesteuerte Spannung nicht auswirken können.
Ein besonderer Vorteil des magnetischen Verdunklers besteht darin, daß nur ruhende Bauteile verwendet werden und daß das Gerät keine Teile enthält, die dem Verschleiß unterworfen sind. Sowohl die elektronischen wie auch die magnetischen Verdunkler für Leuchtstoffröhren arbeiten nach dem eingangs erwähnten Prinzip der Brenndauersteuerung.
Sie haben jedoch den Nachteil, daß bei hohen Verdunkelungsgraden die Brenndauer auf kurze Intervalle innerhalb der Halbwelle verkürzt wird. Hierdurch kann sich u. U. im unteren Helligkeitsbereich ein stroboskopischer Effekt störend bemerkbar machen. Die verhältnismäßig großen Stromlücken können bei der kleinen Aussteuerung mitunter auch Zündschwierigkeiten ergeben, die dadurch hervorgerufen werden, daß im Bereich der kleinen Aussteuerung die Höhe der angeschnittenen Spannungshalbwellen geringer wird, während die Zündspannung der Leuchtstofflampe bei kleinerem Lampenstrom höhere Werte annimmt.
Man war daher gezwungen, die verwendeten Leuchtstofflampen so auszusuchen, daß sie möglichst die gleiche Charakteristik besitzen, d. h. gleiche Brennspannung und gleichen Gasdruck. Trotzdem können auch dann noch Helligkeitsunterschiede und Flackererscheinungen auftreten, wenn die an einen Verdunkler angeschlossenen Leuchtstofflampen im Zuschauerraum unter verschiedenen Temperaturbedingungen arbeiten müssen.
Ein solcher Fall kann z. B. auftreten, wenn ein Teil der angeschlossenen Lampen verdeckt in Vouten untergebracht ist und ein Teil offen verlegt ist.
Diese Schwierigkeiten können nunmehr mit absoluter Sicherheit durch die von Dr.-Ing. JOVY entwickelte „Lichtsteuer-Vorschaltdrossel" vermieden werden, die nach dem Prinzip der Amplitudensteuerung bei gleichbleibender Zündspannung arbeiten. Hierbei wird die Vorschaltdrossel, die infolge der negativen Charakteristik der Leuchtstofflampe erforderlich ist, direkt zur Steuerung des Lichtstromes verwendet. Zu diesem Zweck wird die Vorschaltdrossel als stromsteuernder Transduktor ausgebildet und erhält eine Erregerwicklung, die mit Gleichstrom gesteuert wird. Bei Verwendung der JOVY-Lichtsteuerdrossel steigt die Brennspannung der Leuchtstofflampe bei kleinerem Lampenstrom an und fällt bei extrem kleiner Stromstärke wieder ab. Im Gegensatz zur normalen Vorschaltdrossel, die in ihrer Wirkung den jeweiligen Betriebspunkt schräg anschneidet, arbeitet die Lichtsteuer-Vorschaltdrossel nach einer Konstantstrom-Kennlinie und schneidet die Lampenspannungs-Kennlinie immer senkrecht von oben.
Bilder
Schaltschema einer Helligkeitssteuerung von Niederspannungs-Leuchtstofflampen verschiedener Wattzahl mit JOVY- Lichtsteuer- Vorschaltdrosseln, die auf drei Phasen verteilt sind. (Zeichnung: JOVY)
Kennlinien der JOVY-Lichtsteuer-Vorschaltdrossel. Im Diagramm ist die Lampenspannung der Leuchtstoffröhre bei veränderlichem Lampenstrom aufgetragen. Im Gegensatz zur üblichen Vorschaltdrossel, die den Betriebspunkt schräg anschneidet (gestrichelte Linie), arbeitet die Lichtsteuer-Vorschaltdrossel nach einer Konstantstrom-Kennlinie und schneidet die Lampen-Brennspannungs-Linie stets senkrecht von oben. (Zeichnung: JOVY)
.
Die JOVY-Lichtsteuer-Vorschaltdrossel
Bei der üblichen Vorschaltdrossel verändert sich der Strom in der Leuchtstofflampe bei einer Erhöhung oder Senkung der Netzspannung erheblich, während bei der konstantstrom-gesteuerten Lichtsteuer-Vorschaltdrossel der Strom konstant bleibt. Hierin liegt ein großer Vorteil, da auch bei einem Kurzschluß der Zuleitungen zu den Lampenelektroden der Strom nicht über den eingestellten Wert ansteigen kann.
Die besondere Eigenschaft, daß die Brennspannungs-Kennlinie der Leuchtstofflampe stets senkrecht von oben angeschnitten wird, ermöglicht es auch, daß im Bereich der kleinen Stromstärken, d. h. dort wo die Lampenbrennspannung ansteigt und wieder abfällt, eindeutig festgelegte sichere Betriebspunkte für den eingestellten Helligkeitswert erreicht werden können.
Es konnte festgestellt werden, daß bei einem Lampenstrom von etwa 5mA der kleinste Betriebswert für die Leuchtstofflampe liegt. Bei dieser Stromstärke setzt die Bogenentladung gerade ein. Da andererseits die volle Netzspannung über der Drossel an der Leuchtstofflampe liegt, zündet diese auch mit dieser kleinen Stromstärke sicher und vor allem flackerfrei.
Als zweckmäßig hat es sich übrigens erwiesen, beim Verdunkeln nach dem Erreichen des kleinsten Betriebsstromes die Leuchtstofflampen durch ein Schütz im Steuer-Gleichrichter zu trennen und andererseits beim Einschalten der angeschlossenen Lampen zunächst das Schütz zuzuschalten und dann erst die Lampen auf höhere Helligkeit zu steuern.
.
Arbeitsweise und Ausführung
Der induktive Widerstand der Lichtsteuer-Vorschaltdrossel nimmt mit steigender Vormagnetisierung ab, wobei gleichzeitig der Lampenstrom steigt. Die Drossel ist so ausgelegt, daß bei einem Erregerstrom vom Wert „Null" der Strom in der Leuchtstofflampe noch etwa 5mA beträgt. Parallel zu den Lampenelektroden liegt ein Ausgleichswiderstand, der es ermöglicht, die Charakteristik der Lichtsteuerdrossel so abzugleichen, daß alle angeschlossenen Leuchtstofflampen im kleinsten Strombereich gleichmäßig verdunkelt sind.
Zur Helligkeits-Steuerung werden die Erregerwicklungen sämtlicher Lichtsteuer-Vorschaltdrosseln hintereinander geschaltet und von einem Steuer-Gleichrichter gespeist. Die Einstellung dieses Steuergleichrichters kann entweder von Hand mit Hilfe eines Fernsteurers oder auch durch ein motorisch angetriebenes Stellglied erfolgen, das von beliebig vielen Stellen durch Drucktasten betätigt werden kann.
Die Konstanthaltung des Erregerstromes für die Lichtsteuerdrossel im Steuergleichrichter ist verhältnismäßig einfach. Man erreicht damit, daß der eingestellte Helligkeitswert unabhängig von Schwankungen der Netzspannung und anderen Einflüssen konstant gehalten werden kann und gleichzeitig die Lebensdauer der Leuchtstofflampen wesentlich verlängert wird.
Die JOVY-Lichtsteuer-Vorschaltdrossel zur stufenlosen Verdunkelung von Niederspannungs- Leuchtstofflampen besteht aus einer Vorschaltdrossel in Form eines stromsteuernden Transduktors mit der für die Steuerung der Helligkeit erforderlichen Erregerwicklung, einem Heiztransformator für die Vorheizung der Elektroden und einer Zusatzeinrichtung für die Lieferung einer kapazitiven Zündspannung. Diese Teile sind zu einer Baueinheit fertig verdrahtet zusammengebaut. Hierdurch ist die Montage sehr einfach und erfordert eine nur geringe Arbeitszeit. Die Drossel ist gießharzvergossen und daher unempfindlich gegen Feuchtigkeit und außerdem brummfrei.
Ein amerikanischer Kinoprojektor
Im allgemeinen befaßt sich die kinotechnische Berichterstattung im FV mit deutschen Erzeugnissen, gegebenenfalls - z. B. im Rahmen der Photokina-Berichte - auch mit solchen ausländischen Projektoren, die im Bundesgebiet vertrieben werden. Naturgemäß gibt es im Ausland eine große Anzahl von hochwertigen Kinoprojektoren, die jedoch bei uns nicht bekannt sind, da sie hier nicht verwendet werden. Über einen dieser Kinoprojektoren wurde uns von einem in der Schweiz tätigen deutschen Vorführer berichtet.
Bei diesem amerikanischen Projektor handelt es sich um ein Fabrikat der Fa. WESTREX, der verschiedene Konstruktionsmerkmale aufweist, die von den in Deutschland üblichen abweichen. So haben bei diesem Projektor die Vor- und Nachwickelrollen die gleiche Zähnezahl wie die Schaltrolle (sechzehn Zähne). Der Filmdurchlauf im Bildfenster erfolgt ohne Samtband. Zur Erzeugung eines guten Bildstandes sind unterhalb der Schaltrolle zwei zweiteilig gefederte Andruckkufen angebracht.
Hinter der Schaltrolle läuft der Film über das Tongerät und über eine Ausgleichsrolle zur ersten Nachwickelrolle. Diese Ausgleichsrolle arbeitet im Prinzip wie ein Stoßdämpfer beim Auto, jedoch mit wesentlich höherer Empfindlichkeit, und regelt den ständigen Ausgleich bei Schichtveränderungen und Klebestellen.
Der weitere Filmtransport erfolgt nicht über Beruhigungsrollen, sondern über zwei weitere Nachwickelrollen zur Aufwickelfriktion. Diese Verwendung von drei Nachwickelrollen hat nach Ansicht der amerikanischen Konstrukteure den Vorteil, daß das Filmband einem geringeren Zug unterworfen ist, als bei einem Projektor mit Beruhigungsrollen. Außerdem sollen die kleinen Nachwickelrollen mit 16 Zähnen bei stark geschrumpften Filmen einen besseren Durchlauf gewährleisten, als Nachwickelrollen mit 32 Zähnen.
Nach den amerikanischen Vorschriften ist der Filmlauf des WESTREX-Projektors vollkommen geschlossen, jedoch gut zugängig. Das Gehäuse des Projektorkopfes ist mit einem großen ausschwenkbaren Deckel versehen. Das Getriebe liegt völlig frei, d. h. es läuft nicht in einem Ölbad oder mit Umlaufschmierung. Die Hinterblende, die gleichzeitig zur Luftkühlung dient, ist mit der senkrechten Antriebswelle verbunden. Sie kann - falls erforderlich - während des Filmlaufes verstellt werden. Der Kohlennachschub für die Bogenlampe arbeitet vor- und rückwärts und übernimmt auch das selbsttätige Zünden und die Einstellung des richtigen Kraterabstandes. -Z-
Die Titel-Seite von Heft 12/1963 (Dezember 1963) - 10. Jahrgang
Das ist jetzt die letzte Ausgabe und es ist das Ende des "FILMVORFÜHRER"s.
.
Die film- und kinotechnische Normung
Die film- und kinotechnische Normung wird bekanntlich im „Fachnormenausschuß Kinotechnik für Film und Fernsehen e. V." (FAKI) durchgeführt, der einen Teil des Deutschen Normenausschuß (DNA) bildet und aus insgesamt 18 „Arbeitsausschüssen" besteht, für die jeweils ein Obmann verantwortlich zeichnet.
Diese 18 Arbeitsausschüsse umfassen alle Fachgebiete, die für die Film- und Kinotechnik von Bedeutung sind. Ihre Tätigkeit besteht im wesentlichen darin, vorliegende fachtechnische Probleme zu behandeln und die verschiedenartigen Anforderungen und Ansichten in den einzelnen Sachgebieten so zu verarbeiten, daß nach Möglichkeit eine Vereinheitlichung erzielt und zugleich - sofern hierzu ein besonderer Anlaß vorliegt - eine Anpassung an die internationalen Normen erreicht wird. Das ist z. B. besonders wichtig, "wo" es darum geht, eine internationale Austauschmöglichkeit sicher zu stellen. Man denke dabei nur an die Normung der Filmabmessungen, der Perforation, der Zahnrollen und der Spurlage für die Lichtton- und Magnetton-Aufzeichnungen.
Die Organisation des FAKI ist so getroffen, daß zweimal im Jahr eine Vollsitzung stattfindet, auf der die einzelnen Obleute über ihre Tätigkeit im vergangenen Zeitraum berichten, und nach diesen Berichten und Vorschlägen entsprechende Beschlüsse gefaßt werden, die dann im Laufe der weiteren Bearbeitung nach dem Ablauf einer festgelegten Einspruchsfrist zu einem Normblatt mit der Bezeichnung DIN (Deutsche Industrie-Norm) führen.
Diese Normblätter sind keine „Gesetze" im juristischen Sinn, sondern Empfehlungen für die beteiligten Stellen der film- und kinotechnischen Industrie und für den Vorführbetrieb. Zu den wichtigsten Arbeiten und Beschlüssen des FAKI, die in der letzten Zeit durchgeführt wurden, gehören u. a. der große Filmkern, die Normung der Objektiv-Durchmesser und die Festlegung der Bildgeschwindigkeit.
- Anmerkung : Und wieder wird hier nur geträumt. Die aktuellen und die zukünftigen Normen wurden und werden in den USA gemacht - also festgelegt und die Deutschen und die Europäer durften die so übernehmen oder auch nicht. Alles andere ist reines Geschwafel. Und auch an diesen weltfremden Geschwafel ist der FILMVORFÜHRER am Ende gescheitert.
- Dies ist die allerletzte Ausgabe des FILMVORFÜHRERs .
.
Und jetzt folgt mangels weiterer Themen eine Wiederholung bereits gedruckter Artikel.
Der Redkation des FILMVORFÜHRERs ist vermutlich nicht nur die Lust und das Geld ausgegangen, es sind alle relevanten Themen abgearbeitet und es kam nichts Neues mehr dazu. Auf dies jetzt folgenden Artikel mit allseits bekannten Themen und Inhalten !!! aus alten Zeiten verzichten wir hier :
- Die Entwicklung der Vorführtechnik
- Gestaltung der Bildwerferräume
- Der Vorführbetrieb
- Entwicklung der Lichtquellen
- Projektionseinrichtungen für alle Formate
- Fernsteuerung - Automation
- Aus der Praxis - für die Praxis
- Ausbildung von Vorführer-Nachwuchs
- Vorführer-Prüfungen
- Zuschriften aus dem Leserkreis ...
- Standard-Thema: Kopienbehandlung
- 8mm Kamera mit Lichtregelautomatik
.
Das Wichtigste steht natürlich ganz ganz hinten :
.
DER FILMVORFÜHRER wird "erweitert" ........
Im Januar stellt sich "DER FILMVORFÜHRER" in neuer Aufmachung vor. Verbunden mit dem künftigen Titel "DIE FILMTHEATER-PRAXIS" erfolgt eine Modernisierung des äußeren Bildes und eine Erweiterung des Inhalts. Die zusätzlich angesprochenen Themen umfassen innerbetriebliche Probleme, darunter Anregungen für eine rationeller ausgerichtete Arbeit, Hinweise für die Film- und Dia-Werbung sowie die Gestaltung der Innen- und Außen-Dekoration.
Dem Süßwaren- und Programmverkauf wie arbeitsrechtlichen Fragen werden weitere Beiträge gewidmet sein. Da der Filmvorführer in zahlreichen Betrieben ohnehin mit Aufgaben betraut ist, die über die reine Vorführtätigkeit hinausgehen, wird die Erweiterung dieser Fachzeitschrift seiner täglichen Arbeit besonders dienlich sein.
Die kino-und tonfilmtechnischen Themen werden auch in der FILMTHEATER-PRAXIS angemessene Berücksichtigung finden, und weiterhin bietet sich die Gelegenheit zu fruchtbarem Gedankenaustausch in der Rubrik „Zuschriften aus dem Leserkreis .....".
Die bisherigen Bezieher der Fachzeitschrift "DER FILMVORFÜHRER" erhalten die monatlich erscheinende "FILMTHEATER-PRAXIS" zum unveränderten Bezugspreis. Die Redaktion.
.
Die Argumentation ist natürlich Unsinn - der Markt war weg.
In den letzten 3 Jahren (seit 1960) wurden die Themen immer dünner oder weit weg von den Gedanken und der Aufnahmefähigkeit eines ganz normalen Filmvorführers oder sie wurden so hochtrabend theoretisch und intellektuell, daß er damit gar nichts mehr anfangen konnte. Der Filmvorführer merkte natürlich, daß er ersetzt werden mußte und auch wurde und daß er NICHT das Herz des Kinos war. Das andauernde Hochjubeln des gewissenhaften und unverzichtbaren Filmvorführers ist auch dem "blödesten" aufgefallen, daß das seit Mitte der 1950er Jahre nicht mehr gestimmt hatte.
.
Zum Abschluß mal über den Tellerrand schauen :
.
.